Schulprogramm
Hier finden Sie unser Schulprogramm. Es ist ein wichtiges Steuerungsinstrument, ist das zentrale Konzept, mit dem unser Remigianum seine pädagogischen Ziele, Werte und Entwicklungsschwerpunkte festlegt. Es dient als Leitfaden für unser tägliches Handeln und die kontinuierliche Schulentwicklung im Dialog mit der gesamten Schulgemeinschaft.
Vorwort
Das Schulprogramm bildet den Prozess der Schul- und Unterrichtsentwicklung unserer Schule ab. Es gibt einen Überblick darüber, wie Vorgaben und Entwicklungsprozesse vor dem Hintergrund spezifischer Vorstellungen und Bedingungen an unserer Schule umgesetzt wurden und in Zukunft weiter ausgestaltet werden.
Da ein Schulprogramm immer auch als ein Schulreflexionsprogramm zu verstehen ist, hat es sowohl qualitätssichernde als auch qualitätsentwickelnde Funktionen. Aus diesem Grund werden in diesem Schulprogramm neben der reinen Beschreibung des Schulstandorts Aussagen darüber gemacht, welches Leitbild dem gesamten schulischen Handeln zugrunde liegt, zudem wird dargelegt, welche Bestandsziele bereits erreicht wurden und welche qualitätssichernden Maßnahmen ergriffen werden, um das erreichte Qualitätsniveau zu halten.
Die deskriptive Darstellung der einzelnen Schwerpunkte des Schulprogramms versteht sich als Bericht über die bisherige Entwicklungsarbeit der Schule. Es ist aber auch zentrale Grundlage für eine strukturierte und partizipativ angelegte Unterrichts- und Schulentwicklungsarbeit. Es soll zielgerichtet und ressourcenorientiert Steuerungs- und Planungsprozesse zur Weiterentwicklung der Schule unterstützen.
Mit Einsetzung einer neuen Schulleiterin im April 2022 wurde das im Oktober 2021 verabschiedete Schulprogramm mit den schulischen Gremien Schülervertretung, Elternpflegschaft und Lehrerkonferenz erneut und intensiviert einer kritischen Reflexion unterzogen. Wichtiger und kontinuierlicher Motor der Schul- und Unterrichtsentwicklung an unserer Schule ist die Gruppe „Globale Schulentwicklung“, die aus Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften besteht. Sie fungiert als zentrale Steuergruppe der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Aktuell arbeitet sie beispielsweise an den Themen „Lernen mit digitalen Medien“, „Datenbasierte Schulentwicklung“ und „Implementation von Schulsozialarbeit“.
Auf der Grundlage einer reflektierten Bestandsaufnahme wurden einzelne Teile des Schulprogramms unter Einbeziehung der am Schulleben beteiligten Akteure verändert und aktualisiert, zusätzlich wurden konkrete Entwicklungsbedarfe und Entwicklungsziele benannt.
Zu unserer Schule:
Das Gymnasium Remigianum besteht seit über 600 Jahren. Es hat sich im Laufe der Zeit von einer Lateinschule zu einem sehr modernen Gymnasium entwickelt.[1]
Im Mittelpunkt der gymnasialen Bildung in unserem Gymnasium Remigianum steht der Mensch selbst, der im Sinne von Wilhelm von Humboldt in Auseinandersetzung mit der Welt zu sich selbst findet und seine Kräfte entfaltet. Das Gymnasium Remigianum erfüllt diesen Bildungsanspruch mit einem sehr breit gefächerten Bildungsangebot, bei dem immer der ganze Mensch im Mittelpunkt steht.
[1] Vgl. Bruno Fritsch, Von der Lateinschule zum Gymnasium Remigianum. Die höheren Schulen in Borken von 1417 bis 1955, Bielefeld 2021.
I. Informationen zur Schule
1. Leitbild und Leitbildweiterentwicklung
Das Schulleitbild drückt das gemeinsame pädagogische Grundverständnis unserer Schule in Kurzform aus. Unser Leitbild ist der Kompass, der die Richtung unserer schulischen Gemeinschaft vorgibt. Es spiegelt unsere Werte, Ziele und Visionen wider und dient als Orientierung für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie alle weiteren Akteure unserer Schule. Die Grundlage für unser Schulleitbild ist eine einfache, aber wichtige Frage: Was macht unsere Schule aus, und wohin wollen wir uns gemeinsam entwickeln? Es dient als Evaluationsgrundlage, als ein Maßstab für Qualitätssicherung und als Zielperspektive für Schulentwicklung.
Die Leitsätze konkretisieren die Schwerpunkte unserer Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die den einzelnen thematischen Bereichen zugeordneten Ziele sind als Bestandsziele unserer schulischen Arbeit zu verstehen. Die parallel dazu aufgeführten Formulierungen der an unserer Schule realisierten Qualitätsstandards zeigt an einigen Beispielen, wie die formulierten Ziele an unserer Schule konkret umgesetzt werden. Somit wird belegt, dass es sich bei den Zielformulierungen nicht um Postulate, sondern um wahrnehmbare Schulrealität handelt.
Das Leitbild soll die Vielfalt unserer Gemeinschaft widerspiegeln. Deshalb ist es uns wichtig, möglichst viele Perspektiven einzubeziehen. In Workshops, Umfragen, Gremiensitzungen und auf Konferenzen sammeln und diskutieren wir regelmäßig Ideen, Meinungen und Wünsche. So können wir sicherstellen, dass sich jede und jeder in unserem Leitbild wiederfindet und sich aktiv an der Umsetzung beteiligt. Die zentralen Aspekte, die sich im Laufe des Prozesses herauskristallisiert haben, sind:
- Respekt
- Vielfalt
- Innovation
- Selbstständigkeit
- Demokratie

Die Arbeit am Leitbild unserer Schule unterliegt einer regelmäßigen und konsequenten Evaluierung und Aktualisierung. Prozessorientierung steht im Vordergrund.
So wurde das erstmalig 2018 unter Einbeziehung aller am Schulleben beteiligten Gruppen formulierte Leitbild im Schuljahr 2022/2023 einer intensiven Überprüfung und Aktualisierung unterzogen und z. B. um den inzwischen sehr wichtig gewordenen Aspekt der Nachhaltigkeit ergänzt. Die erneute intensive Auseinandersetzung aller am Schulleben beteiligter Personen mit dem Leitbild und seinen Konkretisierungen hat auch die Dimension von Entwicklungsbedarfen für die Zukunft einbezogen und auf diese Weise wertvolle Impulse für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung gegeben. Beispielhaft seien hier der Wunsch nach Ausweitung des AG-Angebotes, Einrichtung eines bilingualen Angebots, Durchführung eines Schulfestes im Rahmen des Schullebens genannt. Die genannten Aspekte wurden umgehend in Angriff genommen und bereits im folgenden Schuljahr umgesetzt. Andere Entwicklungsimpulse wie zum Bespiel der sinnvolle Gebrauch von digitalen Endgeräten auf dem Schulgelände, ein Strategieplan für den Umgang mit KI und die Stärkung der Lesekompetenzen bilden unter anderen Bereichen Arbeitsschwerpunkte für aktuelle Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse.
Generell werden die Gremien Schülervertretung, Elternpflegschaft und Lehrerkonferenz regelmäßig an der Weiterentwicklung unseres Leitbildes beteiligt. Dies geschieht im Rahmen von Diskussionen und Auseinandersetzungen in themenbezogenen Arbeitsgruppen, in den entsprechenden Gremien und ganz besonders auch in der Steuergruppe „Globale Schulentwicklung“. Regelmäßig überprüfen wir, ob unser Leitbild noch zeitgemäß ist, und passen es, wenn nötig, den aktuellen Herausforderungen an.
Unser Leitbild ist kein starres Dokument, sondern ein lebendiges Element unseres Schullebens. Es ist die Grundlage für Schulentwicklung und damit für das Schulprogramm. Es soll unseren Schulalltag prägen – von der Unterrichtsgestaltung über Projekte bis hin zu schulischen Veranstaltungen.
Die nachfolgenden Übersichten zeigen, wie und wo die Leitsätze aktuell konkret umgesetzt und wahrgenommen werden. Basis der Übersicht waren Befragungen in den drei Gremien Schülervertretung, Schulpflegschaft und Lehrerkonferenz.
RESPEKT
Respekt, Achtsamkeit, Offenheit und Toleranz sorgen für ein gemeinsames Erleben der Schule.
| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |
|
|
INNOVATION
Durch Engagement, Motivation und Qualifizierung sorgen wir für einen Weitblick auf zukünftige Herausforderungen, für innovative Ideen, Nachhaltigkeit und einen modernen Unterricht.
| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |
|
|
SELBSTSTÄNDIGKEIT
Erziehung zu Selbstständigkeit, Verantwortung und kritischer Reflexionsfähigkeit ist das Ziel von qualifiziertem Unterricht.
| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |
|
|
DEMOKRATIE
Demokratische Prinzipien zeichnen die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aus und legen die Grundlage für die gemeinsame Gestaltung unserer Schule.
| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |
|
|
VIELFALT / FÖRDERUNG
Stärken und Begabungen werden durch individuelle Förderung und ein vielfältiges Programm ausgebaut.
| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |
|
|
2. Aktuelles unterrichtliches Bildungsangebot
Das Gymnasium Remigianum ist das größte Gymnasium im Kreis Borken. Aufgrund der Größe der Schule kann die Schule ihren Schülerinnen und Schülern ein sehr großes Lerngebot bereits in der Sekundarstufe I machen, das sich in der Oberstufe fortsetzt. So sind fast alle Kurse auch als Leistungskurse wählbar. Unter anderem durch das umfangreiche Kursangebot, das in der Oberstufe zusätzlich eine Reihe von Projektkursangeboten einschließt, erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Schullaufbahn entsprechend individuellen Neigungen und Schwerpunktsetzungen auszurichten.
Nicht zuletzt durch die Ermöglichung einer stark individualisierten Schullaufbahngestaltung entwickelt unsere Schule eine Strahlkraft, die über die Stadtgrenzen deutlich hinausgeht. So nehmen viele Schülerinnen und Schüler teilweise lange Fahrtwege in Kauf, um gerade die besonderen Möglichkeiten in den MINT-Fächern und das überdurchschnittliche Sprachenangebot wahrzunehmen.
Hinsichtlich der Möglichkeit der Schwerpunktsetzung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ist besonders die Tatsache hervorzuheben, dass unsere Schule als Mint-Excellenz-Schule[1] sehr breit aufgestellt ist. Die lernförderliche Nutzung der Digitalisierung[2] an unserem Gymnasium wurde durch die Auszeichnung als digitale Schule bestätigt.
Im Bereich der Fremdsprachen können neben Englisch die Sprachen Französisch, Spanisch, Latein und Niederländisch gewählt und erlernt werden. Im Fach Japanisch gibt es regelmäßig AG-Angebote. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler beim Fremdsprachenerwerb durch die Möglichkeit, an verschiedenen Austauschprogramm teilzunehmen. Bestätigt wird das große Engagement in den Zertifizierungen als EUREGIO-Profilschule und als Europaschule in NRW.
Weitere Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit sind der künstlerisch-musische Bereich sowie ein umfassendes Angebot im Sportbereich mit der Möglichkeit, bereits jetzt Sport als 4. Abiturfach zu wählen.
In unserer Willkommensklasse befinden sich immer ca. 45 internationale Schülerinnen und Schüler, die auf unterschiedlichen Niveaustufen in der Erstförderung Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werden.[3] Der Unterricht umfasst sowohl DAZ-Unterricht als auch Fachunterricht im Klassenverband. Im Rahmen des DAZ-Unterrichts werden die Schülerinnen und Schüler individuell, ihrem Leistungsniveau entsprechend, unterrichtet und gefördert, sodass die Binnendifferenzierung hier auf jeden Schüler, jede Schülerin zugeschnitten ist.
Eine gleichzeitige Integration in eine alters- und leistungsadäquate Lerngruppe im Rahmen des Fachunterrichts erleichtert die Integration.
3. Aktuelles außerunterrichtliches Angebot
Neben dem rein unterrichtlichen Angebot unserer Schule, das stark individualisierte Schwerpunktsetzungen zum Beispiel durch Profilangebote ab Klasse 5 vorsieht, haben unsere Schülerinnen und Schüler weitere Optionen, die es ihnen ermöglichen, ihre Schulausbildung interessengeleitet zu gestalten.
In nahezu allen Fächern aber auch überfachlich und außerunterrichtlich nimmt das Remigianum an Wettbewerben teil, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an Spitzenwettbewerben, ganze Lerngruppen an Breitenwettbewerben. Hier ein chronologischer Auszug aus den erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen in den letzten Jahren: Jugend debattiert, Jugend forscht, Schüler machen MINT, Essay-Wettbewerb, Bolyai-Wettbewerb, Informatik-Biber, Känguru der Mathematik, Schulradeln, Jugend trainiert für Olympia, EU-Übersetzungswettbewerb, Kopfrechnen-Meisterschaft, Schulschach, Heureka, Europäischer Statistikwettbewerb, Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis, Klimapreis Kreis Borken, freestyle physics, World Robot Olympiad, Mathematikolympiade, Europe4Youth-Wettbewerb, Jugendgeschichtspreis.
Der offene Ganztag ist nach umfangreicher Evaluation in einem Schulentwicklungsprozess in den vergangenen zwei Jahren komplett neu konzipiert worden. Dabei waren sowohl die geänderten Betreuungsbedarfe in der Elternschaft als auch die Interessenslage der Schülerinnen und Schüler sowie die Schaffung von neuen personellen Ressourcen wichtige Aspekte.[4] Neben Betreuungsangeboten und dem Lernbüro gehören vielfältige Arbeitsgemeinschaften regelmäßig zum Nachmittagsangebot, z. B. Fußball, Schulmannschaften „Jugend trainiert für Olympia“, Reiten, Rettungsschwimmen, Schach, Yoga, Schulband, Schulblasorchester, Schulchor, Theater, Backen, Schulgarten, Holzwerkstatt, Basteln, Tastenschreiben, Lego-Mind-Storm, 3-D-Druck-Maker-Space, Diversität, Rechtskunde, Schule mit Courage, Schulsanitätsdienst
Da die Entwicklung jedes Schülers, jeder Schülerin nur dann zur optimalen Entfaltung gelangen kann, wenn diese sich als Teil einer Gemeinschaft wahrnehmen, unternehmen wir an unserer Schule zudem vielfältige Aktivitäten, die dieses Gemeinschaftsgefühl entwickeln und stärken.
Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang der traditionelle „Fit-for-us“ Tag Anfang Oktober, der Rem(m)i-Demmi-Kulturtag, die MINT-Gala, zahlreiche Theateraufführungen unserer Schule sowie regelmäßige Schulfeste genannt.
4. Positionierung in der regionalen Bildungslandschaft
Das Gymnasium Remigianum gehört mit etwa 1300 Schülerinnen und Schülern zu den größten Gymnasien im Regierungsbezirk Münster und ist das größte Gymnasium im Kreis Borken. Die Eingangsklassenbildung erfolgt seit vielen Jahren sechszügig. Schulträger ist die Stadt Borken. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über das Stadtgebiet sowie über Nachbarorte wie Raesfeld, Velen, Heiden und Reken. Insgesamt stammen etwa 50 % der Schülerschaft aus Borken und seinen Ortsteilen, die anderen 50 % aus dem Umland.
Unsere Schule wurde dem Standorttyp 1 zugeordnet. Der Sozialindex für unsere Schule wird vom Ministerium für Schule und Bildung mit 2 angegeben.
Das Gymnasium Remigianum ist das einzige öffentliche Gymnasium in der Kreisstadt Borken. Als solches bildet es zusammen mit den beiden Realschulen in Borken den Rumpf eines dreigliedrigen Schulsystems.
Die Zusammenarbeit mit den beiden Gesamtschulen der Stadt Borken sowie dem benachbarten Berufskolleg und dem privaten Gymnasium in Burlo gestaltet sich ausnahmslos sehr kooperativ. Die Durchlässigkeit der Schulformen funktioniert zuverlässig, auch wenn knappe Schulplätze insgesamt eine Herausforderung darstellen.
Ein umfassendes Übergangsmanagement hinsichtlich des Übergangs Grundschule – Gymnasium, sowie in Bezug auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht die bruchlose Gestaltung von Schullaufbahnen. Aufgrund umfangreicher Beratungs- und Unterstützungsangebote gehen 98 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I in unsere gymnasiale Oberstufe über. Dort werden sie unter Einbeziehung wissenschaftspropädeutischer Methoden und Arbeitsweisen auf das Abitur vorbereitet. Eine Besonderheit ist die sehr hohe Quote an sog. Seitensteigern in der Einführungsphase. Bis zu 40 Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulformen oder Nachbargymnasien entscheiden sich für den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium Remigianum, zumeist aufgrund des großen Fächerangebots in Grund- und Leistungskursen und des guten Rufs, den unsere Schule in der Borkener Schullandschaft genießt. Sowohl aktuellen als auch potenziell zukünftigen Schülerinnen und Schülern ist weithin bekannt, dass das Remigianum sehr viel Wert auf die Ausgestaltung einer Gemeinschaft legt, in der Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen können.
Das Gymnasium Remigianum arbeitet sehr intensiv im Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Borken mit. So nehmen Schulvertretungen regelmäßig an Bildungskonferenzen sowie an Veranstaltungen im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ teil. Als Klimabotschafter und zweifacher Preisträger des Klimapreises des Kreises Borken ist die Schule ein wichtiger Akteur im Klimakreis Borken.
5. Personalausstattung
Am Gymnasium Remigianum arbeiten fast 100 Lehrkräfte, ca. 60 % in Vollzeit und 40 % in Teilzeit.
Von den aufgeführten Lehrpersonen sind drei Lehrerinnen und Lehrer als Fachleiter am Studienseminar Bocholt tätig. Dort bilden sie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in den Fächern Deutsch, Englisch und Spanisch aus.
Vier Lehrkräfte arbeiten neben ihrer rein unterrichtlichen Tätigkeit zusätzlich als Fachberater in unterschiedlichen Fächern eng mit der Bezirksregierung Münster zusammen. Zwei Lehrer sind als Dozenten für Zertifikatskurse in Informatik und Physik regelmäßig teilabgeordnet.
Neben dem Lehrpersonal verfügt die Schule seit vielen Jahren über einen Schulverwaltungsassistenten, der umfangreiche Tätigkeiten im Verwaltungsbereich und für das Kollegium übernimmt.
Referendare und Referendarinnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung sowohl selbstständigen als auch angeleiteten Unterricht erteilen, bereichern unsere Schule. Zudem absolvieren regelmäßig Studentinnen und Studenten ihre Praxissemester oder andere Praktika an unserer Schule.
6. Stand der Digitalisierung
Das Gymnasium Remigianum hat in den letzten Jahren ein umfangreiches Konzept im Bereich der Digitalisierung erarbeitet.[5] Eine zentrale Rolle dabei spielt die Integration von iPads in den Unterricht, wodurch für Schülerinnen und Schüler eine moderne und interaktive Lernumgebung geschaffen wurde, um sie optimal auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten.
Im Rahmen des Digitalisierungsprozesses wurde mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 die Arbeit mit dem iPad in allen Jahrgangsstufen ab der Jahrgangsstufe 5 (2. Halbjahr) eingeführt.
Die Lehrkräfte der Schule werden durch den Schulträger mit individuellen iPads ausgestattet. Die iPads der Schülerinnen und Schüler werden in der Regel von den Eltern angeschafft. Wo dies nicht möglich ist, stellt die Stadt Borken den Schülerinnen und Schülern ein Leihgerät zur Verfügung.
Das digitale Lernmanagementsystem Logineo NRW stellt eine wichtige Basis für individuelles und selbstgesteuertes Lernen dar. Zusätzlich wird damit eine sichere Kommunikationsmöglichkeit geschaffen.
Für den Bildungsauftrag bezüglich künstlicher Intelligenz verfügen alle Lehrerinnen und Lehrer über einen Zugang zu einer Plattform, die einen datenschutzkonformen Zugriff auf KI-Systme ermöglicht.
Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Digitalisierungskonzepts ist die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Stabile WLAN-Verbindungen und leistungsfähige Server gewährleisten einen reibungslosen Ablauf des digitalen Unterrichts und unterstützen die Verwaltung von Lerninhalten.
Die gezielte Nutzung digitaler Medien bereichert das Lernen an unserer Schule und bereitet unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Anforderungen der digitalen Gesellschaft vor.
Die Schule hat aktuell einen Schulentwicklungsschwerpunkt auf der Implementation und die Umsetzung eines KI-Strategieplans gelegt. Dazu werden Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer geschaffen. Zusätzlich ist das Gymnasium Remigianum Referenzschule in einem Netzwerk der Zukunftsschulen NRW, das sich mit dem Thema KI in Schulen auseinandersetzt, sich gegenseitig unterstützt und einen regelmäßigen Austausch dazu pflegt.
Um die Entwicklung des Strategieplans adressatenorientiert zu gestalten, werden Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte durch gezielte Befragungen regelmäßig z. B. über Umfragen in den Prozess einbezogen.
Pad-Einsatz im Unterricht
Die Verwendung von iPads im Unterricht bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Es ist am Gymnasium Remigianum aber auch ganz besonders wichtig, analoge Arbeitsweisen beizubehalten, wo immer dies sinnvoll für den Lernertrag ist, denn für die Erweiterung vieler Kompetenzen können analoge Arbeitsmaterialien und Unterrichtssettings durchaus lernförderlicher sein.
Es ist geplant, dass im Frühjahr 2027 die flächendeckende Einführung der iPads am Gymnasium Remigianum umfänglich datenbasiert evaluiert wird. Aus dem Evaluationsprozess werden dann konkrete weitere Entwicklungsschritte abgeleitet.
Implementation in den Fächern
Die Integration des digitalen Lernens in den Lehrplan erfolgt durch Beiträge aller Fächer auf Basis des Medienkompetenzrahmens. In den Naturwissenschaften können Simulationen und Experimente digital durchgeführt werden, während in den Geisteswissenschaften z. B. interaktive Bücher und Dokumentationen zum Einsatz kommen. In den Fremdsprachen profitieren die Schüler von multimedialen Lernmethoden und authentischen Unterrichtsmaterialien, die das Hör- und Leseverständnis verbessern.
Zukunftsperspektiven
Digitalisierung und KI eröffnen vielfältige Zukunftsperspektiven. Durch digitale Lernplattformen und KI-gestützte Tools wird der Unterricht individueller und flexibler gestaltet. Schülerinnen und Schüler lernen in ihrem eigenen Tempo und erhalten gezieltes Feedback, während ihre Medienkompetenz weiter gestärkt wird. Zukünftig liegt der Fokus verstärkt auf personalisierten Lernprozessen, bei denen KI individuelle Lernwege unterstützt. Ziel ist es, moderne Technologien verantwortungsbewusst und nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren.
Siegel „Digitale Schule“
Wir freuen uns, dass unser Gymnasium mit dem Siegel „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurde. Dieses Siegel würdigt Schulen, die digitale Bildung vorbildlich in den Schulalltag integrieren, innovative Konzepte in den Bereichen Unterricht, digitale Infrastruktur und Lehrerfortbildung umsetzen und zukunftsorientierte Lernmöglichkeiten bieten.
7. Räumliche Bedingungen
Das Hauptgebäude unserer Schule verfügt über 50 Klassenräume und 20 Fachräume, von denen der RemiMAKERSPACE und RemiBREAK-Raum ein besonderes Raumkonzept haben. Der Makerspace steht allen Schülerinnen und Schüler für individuelle Projekte im Bereich des 3D-Drucks zur Verfügung. Im RemiBREAK-Raum finden die offene Ganztagsbetreuung sowie Peer-to-peer-Unterstützungsangebote statt, z. B. die Angebote der Technikscouts.
Die Fach- und Klassenräume unserer Schule sind in medialer und technischer Hinsicht sehr gut ausgestattet. In allen Kurs- und Klassenräumen sind interaktive Smartboards oder Beamer sowie Dokumentenkameras installiert. Die auf den Dienst-iPads von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften erstellten Materialien können in allen Unterrichtsräumen gespiegelt werden.
Zusätzlich zum Hauptgebäude verfügt die Schule über ein multifunktional genutztes Nebengebäude. Hier ist der Schulkiosk sowie ein großzügig angelegter Oberstufen-aufenthaltsraum BASE (Begegnung-Arbeiten-Sprechen-Essen) untergebracht. Hier finden auch Konferenzen und Veranstaltungen des Schullebens statt.
Es stehen für Beratungsgespräche und Gruppensitzungen ausreichend Räume zur Verfügung, die von den Durchführenden selbstständig digital gebucht werden können.
Mit zunehmender Schülerzahl, die sich aufgrund von steigenden Anmeldezahlen sowie der Wiedereinführung des neunjährigen gymnasialen Bildungsgangs ergeben hat, werden weitere räumliche Ressourcen für Unterricht nötig. Diese werden vom Schulträger in einer Dépendance zur Verfügung gestellt, die sich ca. 300 m entfernt im sogenannten Duesbergforum befindet. Hier ist ein längerfristiger Schulentwicklungsprozess mit konkreten Meilensteinen intendiert, in den auch der Schulträger eingebunden ist. Ziel ist eine gelungene aktive Integration der dort ausgelagerten Lerngruppen in die Schulgemeinschaft des Gymnasium Remigianum.
8. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
Im Bereich der Studien- und Berufsorientierung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung, des MINT-EC-Profils, des Europaschulkonzeptes sind besonders intensive Kooperationen entstanden, diese werden gepflegt, regelmäßig evaluiert und weiter ausgebaut.[6]
Realisiert wird die Zusammenarbeit mit einer Öffnung von Schule durch fachbezogene Exkursionen, durch Einladung von außerschulischen Experten, durch fachbezogene Praktika bei externen Partnern, sowie durch Zusammenarbeit mit externen Partnern im Rahmen von Projektkursen.
Ganz besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier sei z. B. auf den Energiepark Saerbeck, die Biologische Station Zwillbrock und die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland in Gescher verwiesen.
Neben dieser Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen in Borken.
An dieser Stelle sei besonders die regionale Schulberatungsstelle mit ihren umfangreichen Unterstützungsangeboten genannt, die von Lehrkräften und Schulleitung aufgrund der Qualität sehr intensiv für Beratung und Fortbildung genutzt wird.
9. Evaluation von Schulentwicklungsprozessen und Weiterentwicklung des Schulprogramms
Die systematische Evaluation schulischer Prozesse ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätsentwicklung am Gymnasium Remigianum. Sie dient sowohl der Qualitätssicherung als auch der gezielten Schulentwicklung.
Ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unserer Schule bestand in der Rückmeldung durch die Qualitätsanalyse im Jahr 2016. Im Zusammenhang mit den im QA-Bericht formulierten Monita wurde der Entwicklungsstand unserer Schule in Form einer Stärken – Schwächenanalyse erfasst und diese in eine Entwicklungsbedarfsanalyse überführt. Auf dieser Grundlage wurden Entwicklungsziele formuliert und priorisiert. Beispielhaft kann hier die Entwicklung eines Leitbildes genannt werden, das konkrete, von der Schulgemeinschaft gemeinsam festgelegte Ziele, sowie deren Umsetzung darlegt. Weitere Entwicklungsschwerpunkte, die in zeitlicher Nähe zur Rückmeldung durch die QA erfolgten, bestanden in der Ausweitung von Teamstrukturen etwa im Zusammenhang mit der „kollegialen Hospitation“ und bei der Einrichtung von Klassenleitungsteams, sowie in der Ausweitung von Förder- und Forderangeboten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich.
Mit dem Wechsel in der Schulleitung 2022 wurde der Ausbau einer systematischen Evaluationskultur am Gymnasium Remigianum noch einmal besonders in den Blick genommen. Dabei wurde eine stärkere Orientierung am Referenzrahmen Schulqualität NRW und am Qualitätszyklus von QUA-LiS NRW umgesetzt.
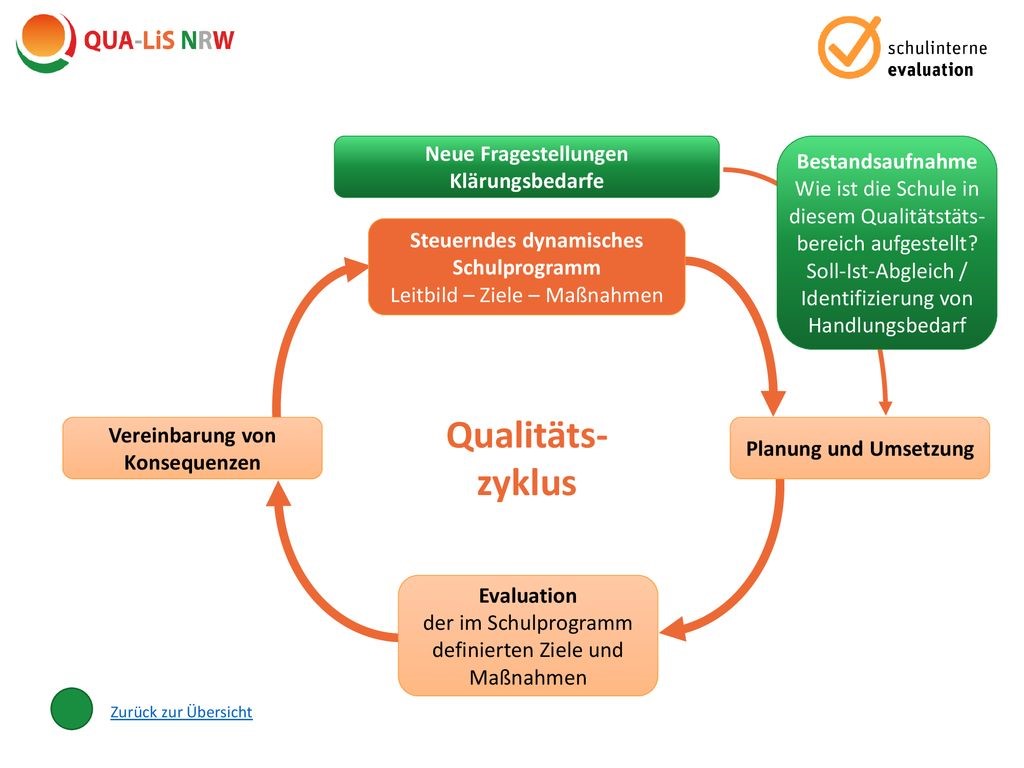
Unser Ziel ist es seitdem, immer mehr datenbasiert Schulentwicklungsprozesse zu steuern, Entwicklungsprioritäten festzulegen und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.
Die Evaluation erfolgt nun in einem kontinuierlichen Zyklus aus Datenerhebung, Analyse, Reflexion und Maßnahmenplanung, sodass schulische Innovationen fundiert und zielgerichtet vorangetrieben werden. Dabei spielt die Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft – insbesondere der Schülervertretung, Elternschaft und Lehrkräfte – eine zentrale Rolle. Wertvolle Ideengeberin ist auch hier die Arbeitsgruppe „Globalen Schulentwicklung“, die aus Vertretern aller Gruppen besteht.
In der Maßnahmenplanung arbeiten wir mit schulinternen Strategieplänen. Sie integrieren eine Zeitleiste, weisen kurz-, mittel- und langfristig Aufgaben für die verschiedenen Akteure aus und nennen Indikatoren zur Überprüfung des Entwicklungsstandes.[1]
Kurzfristige Maßnahmen (Schuljahreszyklus)
Schulentwicklungsprozesse am Gymnasium Remigianum sind aufgrund guter Erfahrungen an unserer Schule wo immer möglich auf Schuljahre ausgelegt. Während des laufenden Schuljahres erfolgen regelmäßige Evaluationen bestehender Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit zu überprüfen und Anpassungsbedarfe frühzeitig zu erkennen.
Ein zentrales Instrument der kurzfristigen Evaluation sind regelmäßige digitale Umfragen mit Edkimo, die in verschiedenen Jahrgangsstufen sowie unter Lehrkräften und Eltern durchgeführt werden. Diese Befragungen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Zufriedenheit, Herausforderungen und Verbesserungspotenziale im Unterricht sowie im gesamten Schulbetrieb.
Ergänzend dazu erfolgt eine systematische Sichtung und Analyse schulischer Leistungsdaten. Vergleichsarbeiten in Klasse 8 (VERA 8), die zentralen Prüfungen in Klasse 10 sowie die Ergebnisse des Zentralabiturs werden in den Fachkonferenzen reflektiert und auf Entwicklungspotenziale hin untersucht. So können Fachschaften gezielt Maßnahmen zur Optimierung des Unterrichts und zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler entwickeln.
Parallel dazu werden fortlaufend Fortbildungsbedarfe im Kollegium zu geplanten und laufenden Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen identifiziert. So können gezielt Maßnahmen entwickelt werden, um die Schulqualität weiterzuentwickeln. Die daraus resultierenden Fortbildungsangebote werden regelmäßig evaluiert, um ihre Effektivität sicherzustellen.[2]
Mittelfristige Maßnahmen (jährliche Planung und Priorisierung)
Jedes Jahr im Mai werden aufgrund der wahrgenommenen Bedarfe die für das kommende Schuljahr vorgesehenen Schulentwicklungsprozesse in den schulischen Gremien (Lehrerkonferenz, Schulpflegschaft, Schülervertretung) vorgestellt.
Anschließend werden Arbeitsgruppen mit klar definierten Zielen und Verantwortlichkeiten gebildet. Jede Arbeitsgruppe wird von einer verantwortlichen Person geleitet und beginnt ihre Tätigkeit nach den Sommerferien. Die Gruppen entwickeln konkrete Konzepte, organisieren Fortbildungen und setzen gezielte Maßnahmen um. Schüler- und Elternvertretungen sind aktiv in die Arbeitsprozesse eingebunden, um die Perspektiven aller Beteiligten zu berücksichtigen.
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen im Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung setzen sich bei gelungenen, erprobten Konzepten für eine breit gestreute Erprobung ein und wirken nach erfolgreicher Evaluation auf eine Implementation der entsprechenden Konzepte in den schulinternen Curricula der Fächer bzw. auf Verankerung im Schulprogramm hin.[3]
Langfristige Maßnahmen (strategische Schulentwicklung und nachhaltige Qualitätssicherung)
Langfristig zielt die Evaluation am Gymnasium Remigianum darauf ab, schulische Qualitätsentwicklung auf einer strategischen und nachhaltigen Ebene zu verankern. Dies geschieht durch eine kontinuierliche Überprüfung und Fortschreibung des Evaluationskonzepts sowie durch eine verstärkte Vernetzung mit externen Qualitätssicherungsinstrumenten.
Dazu gehören:
- Regelmäßige externe Evaluationen (z. B. durch die Qualitätsanalyse NRW)
- Vergleichsstudien und wissenschaftliche Begleitforschung, um Entwicklungen an unserer Schule in größere bildungspolitische Kontexte einzuordnen (z. B. ICILS 2023 im Bereich der Digitalisierung)
Ein besonderer Fokus liegt auf der langfristigen Analyse von Schülerleistungen. Die kontinuierliche Beobachtung von Lernentwicklungen über mehrere Jahre hinweg ermöglicht gezielte Anpassungen in der Unterrichts- und Schulentwicklung. So ruht die Auswertung der VERA8-Ergebnisse z. B. auf zwei Schultern: Während sich die Koordination der Mittelstufe um die Vorbereitung und Durchführung der Vergleichsarbeiten kümmert, liegt die Auswertung der Ergebnisse in den Händen der Koordinatorin für Schulentwicklung, die in enger Zusammenarbeit mit den Fachschaften die Ergebnisse bearbeitet.
Ebenso von zentraler Bedeutung ist die Evaluation der Lehr- und Lernprozesse im digitalen Wandel. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung im Bildungswesen wird regelmäßig überprüft, wie sich der Einsatz digitaler Medien, KI-gestützter Lernmethoden und innovativer Unterrichtsformate auf die Lernqualität und -motivation auswirken. Ein großer Evaluationsprozess ist hier erst für das Schuljahr 2027-28 geplant, weil dann die Arbeit mit iPads und der KI ausreichend implementiert sein wird, um eine verlässliche Datenlage für weitere Steuerungsprozesse zur Verfügung zu haben.
Mikro-Maßnahmen: Flexible Anpassungen für eine agile Schulentwicklung
Neben den dargestellten langfristig geplanten Evaluationsprozessen setzt das Gymnasium Remigianum gezielt Mikro-Maßnahmen ein. Diese Maßnahmen werden ad hoc bei unmittelbarem Handlungsbedarf oder zur direkten Optimierung kleinerer Prozesse umgesetzt. Sie ermöglichen eine schnelle Reaktion auf aktuelle Herausforderungen, ohne umfangreiche Abstimmungsprozesse.
Typische Mikro-Maßnahmen sind beispielsweise spontane Anpassungen im Schulalltag, Optimierungen von Kommunikationswegen, kleine strukturelle Verbesserungen im Unterrichtsablauf oder die Einführung effizienterer organisatorischer Abläufe. Auch schüler- oder elternseitige Anregungen können auf diese Weise schnell und unbürokratisch Berücksichtigung finden.
Mikro-Maßnahmen stärken die agile Schulentwicklung wahrnehmbar. Sie tragen zu großer Zufriedenheit bei, weil Verbesserungen unmittelbar spürbar werden, ohne langwierige Entscheidungsprozesse abzuwarten. Die Selbstwirksamkeit der Ideengeber wird unterstützt. Eingesetzt werden Mikromaßnahmen allerdings nur, wenn eine von allen Seiten reibungsfreie Umsetzung garantiert ist. Beispielhaft seien hier die Themen „Regenpause“ und „Umgang mit rassistischen Äußerungen im Schulalltag“ genannt.
Evaluation im Kontext Unterricht
Unterricht am Gymnasium Remigianum basiert auf einer starken Feedbackkultur. Regelmäßige Feedbackgespräche, digitale Umfragen und gezielte Reflexionsphasen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ihre Wahrnehmung des Unterrichts einzubringen und aktiv an der Gestaltung der Lernprozesse mitzuwirken.
Gleichzeitig pflegen wir eine positive Fehlerkultur: Fehler werden als Teil des Lernprozesses verstanden und gezielt genutzt, um Denkprozesse zu fördern und nachhaltiges Verstehen zu ermöglichen. Lehrkräfte setzen bewusst Methoden ein, die eine offene Fehleranalyse ermöglichen, etwa durch gemeinsame Reflexion von Lösungswegen und fehlerfreundliche Lernräume. Ziel ist es, durch Feedbackschleifen die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler zu stärken und ihre Lernstrategien nachhaltig zu verbessern.
Zusammenfassung
Das Gymnasium Remigianum versteht Evaluation nicht als isolierte Bestandsaufnahme, sondern als lebendigen und dynamischen Prozess, der eine nachhaltige Schul- und Unterrichtsentwicklung ermöglicht. Die strukturierte und systematische Verankerung der Evaluationsmaßnahmen gewährleistet, dass schulische Veränderungsprozesse zielgerichtet, datenbasiert und partizipativ gestaltet werden. Evaluation ist damit eine wichtige Basis für die weitere Schulprogrammarbeit.
[1] Siehe exemplarischer Strategieplan für den Schulentwicklungsprozess „Umgang mit KI“
[2] Siehe gesondertes Konzept FORTBILDUNG
[3] Konkretes dazu im Abschnitt zur Qualitätsentwicklung.
[1] Siehe gesondertes Konzept MINT
[2] Siehe gesondertes Konzept LERNEN UND LEHREN MIT DIGITALEN MEDIEN
[3] Siehe gesondertes Konzept ERSTFÖRDERUNG
[4] Siehe Übersicht REMI AM NACHMITTAG .
[5] Siehe gesondertes Konzept LERNEN UND LEHREN MIT DIGITALEN MEDIEN
[6] Siehe gesonderte Konzepte KAOA, MINT
II. Unterricht
1. Gemeinsames Qualitätsverständnis von Unterricht
Der folgende Text ist das Arbeitsergebnis der intensiven Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Qualitätsverständnis von Unterricht am Gymnasium Remigianum innerhalb der Lehrerkonferenz. Die Aussagen erfreuen sich einer hohen gleichsinnigen Akzeptanz im Kollegium. Diese Akzeptanz unterstützt die Umsetzung des gemeinsamen Qualitätsverständnisses im eigenen, konkreten unterrichtlichen Handeln maßgeblich.
Der Unterricht ist so angelegt, dass er im Rahmen von Richtlinien und Lehrplänen kognitiv aktivierende Inhalte auswählt, die von ihrem Lerngehalt her exemplarischen Charakter haben. Zudem sollen durch den Unterricht problemlösende Kompetenzen gefördert werden. Es werden Methoden verwendet, die sowohl individuelle als auch gemeinsame (kooperative Methoden) Formen der Aneignung erlauben. Die Lehrkraft instruiert, moderiert, unterstützt Lernprozesse und fördert Selbststeuerungskompetenzen zum Beispiel mithilfe von Kompetenzrastern in ausgewogener Balance. Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständig, kooperativ sowie methodenbewusst und tragen durch Aufmerksamkeit und Mitarbeitsbereitschaft zu einem gelingenden Unterricht bei.
Die Lehrkräfte richten den Unterricht an Richtlinien und Lehrplänen aus, aber auch an dem Lernfortschritt und den Verstehensprozessen jedes einzelnen Lernenden. Binnendifferenzierende Maßnahmen unterstützen in angemessenem Maße den Lernprozess des einzelnen Lernenden. Die Unterrichtsmethoden entsprechen dem Stand der modernen Unterrichtsentwicklung. Kolleginnen und Kollegen erproben neue Unterrichtsmethoden und vermitteln der Fachschaft ihre Erfahrungen. Dies erfolgt im interkollegialen Austausch, zum Beispiel im Rahmen von kollegialen Hospitationen aber auch auf den Fachkonferenzen der einzelnen Fächer. Weitere Formen der unterrichtlichen Absprache ergeben sich durch verbindliche Absprachen im Rahmen von Fachkonferenzen aber auch durch gemeinsam erstellte Klassenarbeiten und Klausuren.
Die Lehrpersonen nehmen angesteuerte Lernziele und Lernprozesse aus der Perspektive der Lerngruppe und des einzelnen Lernenden wahr, vermitteln vielfältige Lernstrategien und stärken das Zutrauen der Lernenden in die eigenen Fähigkeiten. Fehler werden als Feedback für den momentanen Stand des Lernprozesses verstanden und als Gelegenheit genutzt, Klärung und Vertiefung herbeizuführen – unter Einbeziehung der gesamten Lerngruppe. Die Schulleiterin sorgt gemeinsam mit den Fachkonferenzen für die Umsetzung von Curricula, Konzepten zur individuellen Förderung und Konzepten zu selbstständigem Lernen. Im Rahmen der Sicherung von Qualität des Unterrichts kommt der Teambildung der Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Bedeutung zu. Maßnahmen im Bereich Teambildung entstehen unter anderem durch die Durchführung eines konzeptionell gestützten Onboardingprozesses, der auch dazu dienen soll, neue Fachkollegen möglichst schnell in die Fachschaften zu integrieren, um unterrichtliche Absprachen zu erleichtern. Zudem werden neue Kolleginnen und Kollegen in einführenden Veranstaltungen zu Beginn ihrer Tätigkeit am Gymnasium Remigianum auf den praktizierten Stand der Unterrichtsentwicklung gebracht und sie lernen hier vereinbarte Konzepte kennen.
Die Lehrerinnen und Lehrer aller Fachschaften und die Fachschaftsvorsitzenden fördern die Zusammenarbeit der Fachschaften untereinander: Materialien, Methodensammlungen, Arbeitsblätter, Klausuren und Klassenarbeiten werden (digital z. B. auf Logineo) bereitgestellt und ausgetauscht. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Vergleichbarkeit von gemeinsamen unterrichtlichen Standards, sowie auf Fachschaftsebene abgesprochene Standards der Leistungserwartungen und Leistungsbeurteilung zu sichern. Für die Lernenden entsteht Transparenz hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und Leistungserwartungen in den verschiedenen Fächern, unter anderem durch die Hinweise auf Unterrichtsinhalte und Beurteilungskriterien zu Beginn eines jeden Schuljahres.
Um unterrichtliche Kontinuität zu erreichen, hält das Gymnasium Remigianum ein Vertretungskonzept vor, das in Vertretungsstunden nach Möglichkeit die kontinuierliche Erteilung von Fachunterricht vorsieht.
Bei vorhersehbarem Unterrichtsausfall bereiten die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer für die Vertretungslehrer Material vor, das die Kontinuität des Unterrichts gewährleistet. Entsprechendes Lehr- und Lernmaterial wird, sofern möglich, von den zu vertretenden Lehrkräften auf Logineo hochgeladen. Bei längerfristigem Unterrichtsausfall, z.B.: Elternzeit oder langfristigen Erkrankungen, wird der Unterricht dauerhaft von fest eingesetzten Fachkolleginnen und Fachkollegen vertreten.
Um unseren Schülerinnen und Schülerinnen die Teilnahme am digitalen Unterricht zu ermöglichen, erhalten auch diese gezielten Einführungen in den Umgang mit Logineo LMS und Logineo NRW sowie Unterstützungsangebote im Hinblick auf das digitale Lernen und den Umgang mit dem IPad. Der Umgang mit KI erfolgt in Abstimmung mit den Fachschaften gemäß der vom Land NRW herausgegebenen Richtlinien.
Neben digitalen Unterrichtsangeboten und Lernarrangements erhalten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auch weiterhin analoge Unterrichts- und Lernangebote, die je nach unterrichtlichen Voraussetzungen und Zielsetzungen eingesetzt werden.
Inzwischen wurde das Klassenbuch von analog auf digital umgestellt. Medien, iPads insbesondere auch das Smartboard und in einigen Räumen Dokumentenkameras werden genutzt, um Anschaulichkeit und Effizienz des Unterrichts zu gewährleisten. Im Medienkonzept sind im Sinne eines Spiralcurriculums der Umgang mit Medien und die Reflektion ihrer Verwendung festgelegt. Die Einrichtung eines Selbstlernzentrums mit einer Reihe von Rechnern, die den Schülerinnen und Schülern jederzeit zur Verfügung stehen, und einer interaktiven Tafel erlaubt die eigene Recherche auch außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Einführung in erste Schritte zur Textverarbeitung und die Einbindung in das EDV-System erfolgt in den Ergänzungsstunden (Forschen und Entdecken, Leselust, Musik Aktiv, Englisch Plus). Ein Methodencurriculum sichert fächerübergreifend die verlässliche Einführung von methodischen Kenntnissen und Fertigkeiten.
Im Oberstufenunterricht ist neben den klassischen „Fachraumfächern“ für einige Fächer das Fachraumprinzip (Niederländisch, Erdkunde,) eingeführt worden. Diese Räume sind mit den erforderlichen Medien und Nachschlagewerken ausgestattet. Die Lern- und Unterrichtsumgebung ist in modernen, renovierten Klassenzimmern ansprechend gestaltet. Der Schulträger sorgt für eine adäquate Ausstattung.
2. Schülerorientierung: Individuelle Förderung
Der Regelunterricht orientiert sich am Gymnasium Remigianum in hohem Maße an individueller Förderung. Exemplarisch sei hier auf die in allen schriftlichen Fächern eingeführten Kompetenzraster zur individuellen selbstverantwortlichen Arbeit hingewiesen. Aspekte der inneren Differenzierung sind wichtige Basis des Unterrichts.
Daneben hält die Schule ein umfangreiches Angebot an Förder- und Forderunterricht vor:
Förderangebote
Unser Förderkonzept basiert auf verschiedenen Säulen:
- Differenzierte Lernangebote: In den Kernfächern bieten wir Profilkurse und Arbeitsgemeinschaften an, um kleine Lernlücken zu schließen oder mehr Lernzeit zu schaffen. In Lernbüros können die Schülerinnen und Schüler kostenfrei mit älteren Remigianern lernen und Fragen zum Unterrichtsstoff stellen.
- Fachunterricht: Schon in den regulären Stunden gehen die Fachlehrkräfte auf die zunehmende Heterogenität der Klassen ein. Sie diagnostizieren besondere Kompetenzen aber auch Lernschwierigkeiten. Auf dieser Basis wird der Fachunterricht geplant und durchgeführt
- Lese– und Rechtschreibschwierigkeiten: Ein umfassendes Konzept für den Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sorgt auch in diesem Bereich für eine gezielte Förderung und lässt keinen Nachteil für den Besuch eines Gymnasiums entstehen. Alle Deutschlehrerinnen und -lehrer verfügen über eine gezielte Schulung in dem Bereich und ein spezielles Beratungsteam sorgt für eine kontinuierliche Begleitung im Förderprozess.
- Förderung stillerer Kinder: Besonders für die eher stilleren und zurückhaltenden Kinder ist der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule oft ein großer Schritt. Hier ist es besonders wichtig, die Kinder mit ihren individuellen Charaktereigenschaften ernst zu nehmen und zu respektieren. Genauso wichtig ist es aber auch, ihnen gezielte Hilfestellungen anzubieten, die es ihnen erleichtern, sich im Unterricht zu melden und ihre Ängste abzubauen. Zu diesem Zweck haben wir ein Programm entwickelt, das gezielt Techniken für den Ausbau der mündlichen Mitarbeit vermittelt und die Lernenden bei diesem Prozess unterstützt.
- Persönliche Beratung: Regelmäßige Beratungsgespräche mit unseren erfahrenen Lehrkräften helfen dabei, individuelle Stärken und Schwächen zu identifizieren und passende Fördermaßnahmen zu entwickeln.
Forderangebote
Individuelle Förderung bedeutet für uns, am Gymnasium Remigianum, auch spezifische Begabungen und Interessen zu erkennen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine gezielte Begabungsförderung.
Unsere Schule bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um die vielfältigen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler zu erkennen und zu fördern. Dabei betrachten wir sowohl kognitive als auch kreative, musische und sportliche Begabungen. Für jedes, in einem Spezialbereich begabten Kind, bieten wir unterschiedliche und maßgeschneiderte Programmbausteine an.
Unser Begabungsförderungskonzept basiert auf folgenden Säulen:
- Unterrichtliche Förderung
Beherrscht ein Schüler oder eine Schülerin den Lernstoff bereits, können beispielsweise weitere Übungseinheiten durch unterrichtliche Projekte ersetzt werden. Ziel dieses Compactings ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in der gewonnenen Zeit selbstständig eigenen Interessen und Stärken nachgehen, sich in angereicherte Inhalte vertiefen, Kompetenzen erwerben oder Aufgabenstellungen – möglichst nach persönlichem Interesse ausgewählt – freudvoll und anstrengungsbereit bearbeiten können. So vermeidet man, dass sie lediglich eine Helferrolle für langsamere Lerner übernehmen oder Langeweile die Lernmotivation verringert.
- Drehtürmodelle
Nach einer intensiven Beratung von Eltern und den betroffenen Kindern kann man auch zusätzliche Angebote als Drehtürmodell schaffen. Ein typisches Beispiel ist die Parallelbelegung von zwei Fremdsprachen in Klasse 7 oder das digitale Drehtürangebot, das Schülerinnen und Schüler in Übungsphasen im Unterricht an Workshops und Webinaren mitarbeiten lässt, die fächerübergreifend sind und in allen Interessensbereichen Angebote schaffen.
- Ferienprogramme
Auch neben der Schule bieten wir den Schülerinnen und Schüler interessante Projekte überregionaler Kooperationspartner an, die Angebote für besonders talentierte Kinder schaffen. So arbeiten wir z.B. mit den Lernferien NRW zusammen und der Deutschen Juniorakademie NRW. Naturwissenschaftlich Interessierte nehmen an verschiedenen MINT-Camps teil.
- Wettbewerbe
Viele Wettbewerbe sind interessante Möglichkeiten, den eigenen Interessen nachzugehen und in kleinen Gruppen Fähigkeiten auszubauen. Sprachliche Angebote wie Jugend debattiert oder auch naturwissenschaftliche Programme wie Jugend forscht oder Jugend präsentiert halten für alle Interessensbereiche eine Vielzahl von attraktiven Chancen bereit. Im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia fordern wir unsere sportlichen Talente.
3. Fremdsprachen und Europaschule
Das Gymnasium Remigianum legt großen Wert auf ein umfassendes Fremdsprachenangebot, das die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einer globalisierten Welt vorbereitet. Unsere Schule bietet neben dem Pflichtunterricht in Englisch auch bilingualen Unterricht im Wahlpflichtbereich II (Geschichte) an. Zudem können die Schülerinnen und Schüler Spanisch, Französisch, Niederländisch, Latein und als Arbeitsgemeinschaft Japanisch erlernen. Dieses vielfältige Angebot ermöglicht es ihnen, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln.
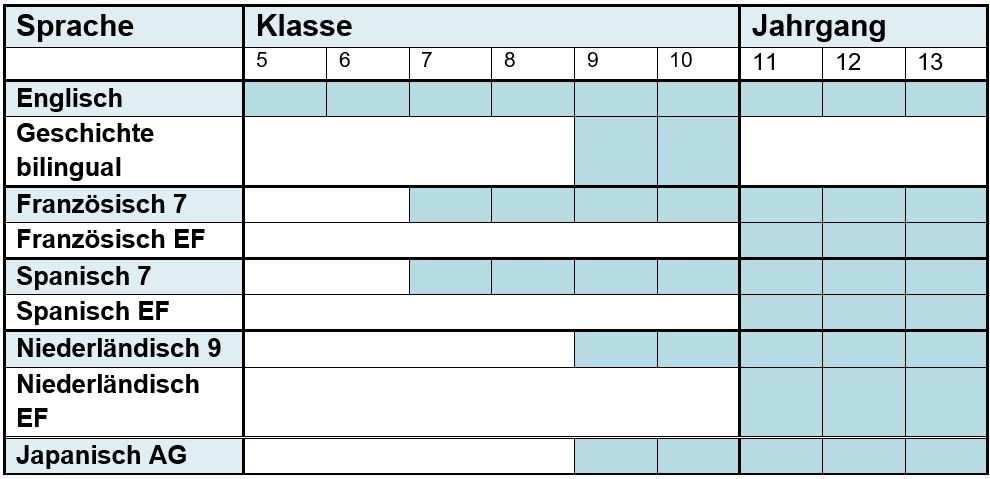
Um die erworbenen Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden und zu vertiefen, fördern wir den internationalen Austausch. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an Exkursionen in die benachbarten Niederlande oder nach Belgien teilzunehmen. Darüber hinaus pflegen wir Schüleraustausche mit Partnerschulen in Frankreich, Spanien, die Niederlande und Argentinien. Diese Begegnungen bieten wertvolle Einblicke in andere Kulturen und fördern das Verständnis für globale Zusammenhänge.
Ein weiterer Baustein unseres Fremdsprachen- und Europakonzepts ist die Vorbereitung auf außerschulische Sprachzertifikate. Durch gezielte Vorbereitungskurse können unsere Schülerinnen und Schüler Zertifikate in Englisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch erwerben. Diese Zertifikate sind im späteren Berufsleben oder an Universitäten im Ausland willkommene Türöffner und unterstreichen die Qualität unserer sprachlichen Ausbildung.
Im WPII-Bereich ist das Fachangebot „Geschichte bilingual“ eingeführt werden. Der bilinguale Geschichtsunterricht soll nicht einfach Geschichtsunterricht in der Fremdsprache sein, sondern soll das Behandeln von Themengebieten erlauben, die in einem besonderen Maße einen bilingualen Mehrwert enthalten. Solche von englischsprachigen Kulturräumen geprägten Themenbereiche sind die ideale Ausgestaltung eines auf interkulturelle Kompetenz und vertieftes Verständnis ausgerichteten Konzeptes.
Unsere Bemühungen im Bereich der Fremdsprachen und der internationalen Ausrichtung wurden inzwischen durch die Auszeichnung als Europaschule gewürdigt. Diese Zertifizierung durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist die höchste schulische Auszeichnung für internationale Aktivitäten. Schon lange ist unsere Schule zudem Euregio-Profilschule aufgrund unserer vielfältigen Aktivitäten mit unseren niederländischen Nachbarn.
Als Euregio-Profilschule und als Europaschule setzen wir uns dafür ein, das Verständnis für europäische Werte und Kulturen zu fördern. Durch Projekte, Austauschprogramme und europabezogene Unterrichtsinhalte möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger in einem vereinten Europa zu agieren. Unsere Schule versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Vielfalt gelebt und geschätzt wird – in einer Welt, in der das immer weniger wahrnehmbar wird.
Zusammenfassend bietet das Gymnasium Remigianum ein breitgefächertes Fremdsprachenangebot, das durch internationale Austauschprogramme und die Möglichkeit zum Erwerb von Sprachzertifikaten ergänzt wird. Die Auszeichnung als Europaschule unterstreicht unser Engagement für eine europäische und interkulturelle Bildung, die unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen einer globalisierten Welt vorbereitet.
4. Naturwissenschaften und MINT-EC-Schule
Eine fundierte Ausbildung im Bereich der Naturwissenschaften ist zentraler Bestandteil der Schule. Das Gymnasium Remigianum ist seit 2001 zertifizierte MINT-EC-Schule. Dieses Zertifikat des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC unterstreicht das Engagement, Schülerinnen und Schüler in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) besonders zu fördern.
Schon ab Klasse 5 können Schülerinnen und Schüler individuelle Schwerpunkte im MINT-Bereich durch das Fach „Forschen und Entdecken“ legen. Offenes Experimentieren, themengebunden an Forscherfragen zu Alltagsphänomenen zu arbeiten, legt die Grundlage für wissenschaftliche Arbeitsmethoden und bindet die kindliche Neugier in den Schulalltag ein.
Diese erste Schwerpunktsetzung kann im Rahmen der Differenzierungskurse ab Klasse 9 fortgeführt werden. Hier bieten wir drei zusätzliche MINT-Fächer an: Informatik, „Expedition Mensch“ (Sport/Biologie) und „Forschen und Erfinden“.
Ein volles Angebot an Grund- und Leistungskursen in allen Naturwissenschaften runden das Profilangebot in der Oberstufe ab. Ergänzend können bei entsprechenden Anwahlen Projektkurse zu den Themen Hochschulmathematik, Forschen und (Software-)Entwickeln, Showchemie oder Mechatronik gewählt werden.
Um auf ein Leben in der digitalen Zukunft vorzubereiten, sind Angebote der Informatik über die gesamte Schullaufbahn wählbar.
Neben dem Abitur beenden unsere Schülerinnen und Schüler ihre Laufbahn mit dem MINT-Zertifikat. Dieses kann bei der Bewerbung um Studienplätze und Stipendien genutzt werden.
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern bereichert das unterrichtliche Arbeiten und schafft neben berufsorientierenden Perspektiven Einblicke in die technische Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.
Im Informatikunterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler z.B. das Programmieren in Projekten, die von den Firmen d.velop und CONTENiT als Aufträge der Unternehmen gestellt und durchgehend betreut werden. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung professionell präsentiert, so dass auch die Darstellungs- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer geschult wird. Weitere Kooperationspartner unserer Schule sind die Firmen Evonik und die westfälische Hochschule Bocholt.
Viele sehr erfolgreiche Teilnahmen am Wettbewerb Känguru der Mathematik, an den Mathe-, Chemie-, Biologie- und Physikolympiaden, an freestyle physics, am BIBER-Wettbewerb, am europäischen Statistikwettbewerb, an der First-LEGO-League und der World Robot Olympiad sprechen für das starke Interesse und Engagement unserer Schülerinnen und Schüler sowie für eine qualifizierte Vorbereitung durch unsere Lehrkräfte.
Die hierzu nötigen Projekte können in einer eigenen MINT-Werkstatt (der REMI_MAKER_SPACE), die mit modernen Werkzeugen wie 3D-Druckern und Robotertechnik ausgestattet ist, angefertigt werden.
Durch dieses vielfältige Angebot möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Anforderungen einer technisierten und digitalisierten Welt vorbereiten und ihr Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen wecken.
5. Sport- und Bewegungsangebote
Im Sportunterricht werden am Remigianum motorische, kognitive und soziale Kompetenzen erweitert. In den einzelnen Jahrgangsstufen stehen verschiedene Sportbereiche auf dem Lehrplan. Sportbereiche mit individuellem Schwerpunkt werden jedes Jahr weiterentwickelt, das Sportspiel „Basketball“ wird in Klasse 6 eingeführt und in Klasse 8 sowie 10 vertieft. Der Bereich „Bewegen im Wasser – Schwimmen“ wird in den Klassen 5, 7 und 8 unter verschiedenen Schwerpunkten behandelt. Dabei ist uns die Förderung von Nichtschwimmern ein besonderes Anliegen.
Im Bereich der Erprobungsstufe (Klasse 5 und 6) erweitern Sportförderkurse und auch Arbeitsgemeinschaften (z.B. Schwimmen) die Inhalte des Sportunterrichts.
Im Wahlpflichtbereich II (Klasse 9 und 10) können die Schülerinnen und Schüler den Kurs Sport/Biologie anwählen, in dem neben biologischen Grundlagen sportlicher Leistungen vor allem die praktische Umsetzung von Sportarrangements im Mittelpunkt steht. Die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zum sogenannten „Sporthelfer“ findet im Laufe der zwei Jahre im Kurs statt.
In der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler das Fach Sport als 4. Abiturfach (Grundkurs) belegen und somit eine fachpraktische Prüfung (bestehend aus zwei praktischen und einem theoretischen Teil) ablegen.
Regelmäßige Aktivitäten:
Die Fachschaft Sport veranstaltet das Sportfest für die Klassen 5 bis 10. Dieses Sportfest wird im jährlichen Wechsel unter verschiedenen Schwerpunkten (Spielsportfest, Bundesjugendspiele) durchgeführt.
Die Schulskifahrt der Jahrgangsstufe 8 mit dem Ziel Südtirol (Italien) wird durch die Fachschaft Sport organisiert und durchgeführt.
Im Zuge des Sportunterrichts werden Sportabzeichen bzw. Schwimmabzeichen erworben.
Bei diversen Sportwettkämpfen in verschiedenen Sportarten (z.B. Volleyball, Basketball, Leichtathletik, uvm.) tritt das Gymnasium Remigianum mit Schulmannschaften an. Auch bei lokalen Sportevents (Citylauf Borken, Stadtradeln) starten Remigianerinnen und Remigianer.
Durch eine sehr gute Infrastruktur im Bereich der Sportanlagen kann der Sportunterricht kompetenzorientiert und somit lehrplankonform durchgeführt werden. Hierbei gleichen die Sportlehrkräfte in Rahmen der Fachschaftsarbeit die Unterrichtsmethoden und Leistungsbewertungskriterien ab und bilden sich in schulinternen sowie allgemeinen Fortbildungen andauernd fort.
Im Rahmen des Wahlpflichtbereichs II (Klasse 9 und 10) wird der Kurs „Sport-Biologie“ angeboten, wo Schülerinnen und Schüler neben Wissen über sportliche Bewegungen auch Fähigkeiten für das Anleiten von Übungseinheiten erwerben (Sporthelfer-Ausbildung).
Durch das Angebot von Sport als 4. Prüfungsfach wurde im Bereich der Oberstufe der wichtige Bereich „Fitness“ implementiert, der die Schülerinnen und Schüler auf lebenslanges, gesundheitsförderndes Sporttreiben vorbereiten soll.
Zu den Unterrichtsinhalten kommen vielfältige außerunterrichtliche Sportangebote, in deren Rahmen Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern können. Dazu zählen Arbeitsgemeinschaften (z.B. Schwimmen und Reiten), Teilnahme an Sportwettkämpfen (lokal: z.B. Citylauf Borken – regional: z.B. Stadtradeln, überregional: z.B. „Jugend trainiert für Olympia“) und die Klassenfahrt in Klasse 8, die als Skifahrt im Fahrtenprogramm und Schulprogramm verankert ist.
Planungen für die Unterrichtsentwicklung schließen die folgenden Aspekte ein:
Im Bereich der Bewegungsförderung soll Sport- und Schwimmförderunterricht in Klasse 5 implementiert werden. Im Bereich der aktiven Bewegungspausen soll das gesamte Kollegium hilfreiche Anregungen zur Nutzung im Schulalltag erhalten.
In der gymnasialen Oberstufe soll im Zuge der neuen APO-GOst ein Projektkurs Sport entwickelt werden. Zudem sollen die Bewegungspausen und der Pausensport durch ausgebildete Lehrkräfte und die Sport-Biologie-Kurse erweitert werden. Schwerpunkt der fachinternen Evaluation soll die erneute Evaluation der Oberstufenlehrpläne sein.
6. Musik
Musik hat am Gymnasium Remigianum einen hohen Stellenwert und wird von einem engagierten Team aus Fachlehrkräften unterrichtet. Die personellen Ressourcen sind im Bereich Musik seit einigen Jahren äußerst knapp, so dass wir, wo immer es geht, mit der Musikschule Borken kooperieren, die im selben Gebäudekomplex untergebracht ist.
Bereits in der Erprobungsstufe bieten wir mit dem Profilkurs „MusikAktiv“ eine praxisorientierte Ergänzung zum regulären Musikunterricht an. Hier können Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren sammeln – eine Minimalversion der klassischen Bläserklasse. In Klasse 6 wird „MusikAktiv“ als Ergänzungsstunde fortgeführt.
Über den Unterricht hinaus bereichert ein vielfältiges musikalisches Angebot das Schulleben. Dazu gehören eine Schülerband, das Schulblasorchester sowie das Kooperationsprojekt „Ein Instrument erlernen“ mit der Musikschule Borken. In diesem Rahmen können verschiedene Blasinstrumente, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug im Gruppenunterricht erlernt werden.
Ein Schulchor ebenfalls in Kooperation mit der Musikschule befindet sich im Aufbau.
7. Erst- und Anschlussförderung (Willkommensklasse)
Das Gymnasium Remigianum setzt sich aktiv für die Integration neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler ein.[1] Derzeit besuchen rund 45 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Nationen unsere Willkommensklasse. Die Altersstruktur reicht von 11 bis 17 Jahren, die sprachlichen Vorkenntnisse bewegen sich zwischen den Niveaustufen A0 (Alphabetisierung) und B1.
Im Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) werden ungesteuerte und gesteuerte Spracherwerbsprozesse gezielt zusammengeführt. Dabei berücksichtigen die Lehrkräfte die individuellen Lernstände der Schülerinnen und Schüler und fördern ihre sprachlichen Kompetenzen gezielt. Zusätzlich erhalten die Lernenden Unterstützung in den Fächern Mathematik und Englisch. Der Unterricht erfolgt in kleinen bis mittelgroßen Gruppen, oft im Team-Teaching, um eine optimale Differenzierung, individuelle Sprachförderung sowie gezieltes Feedback zu ermöglichen.
Parallel zur Förderung in der Willkommensklasse nehmen die Schülerinnen und Schüler schrittweise am Regelunterricht teil. In enger Absprache mit den Fachlehrkräften erfolgt eine zielgleiche oder -differente Integration in altersgerechte Klassen. Dabei kommt dem sprachsensiblen Fachunterricht eine besondere Rolle zu. Die Leistungen werden durch Zeugnisse, individuelle Beiblätter sowie Bewertungsbögen zum Lernstand im Fach DaZ dokumentiert.
Die Willkommensklasse bleibt – orientiert an den Zuweisungen durch das Schulamt – ein fester Bestandteil unseres Schulkonzepts. Ziel der DaZ-Förderung ist die kontinuierliche Verbesserung produktiver (Ausdrucksfähigkeit, Textproduktion) sowie rezeptiver (Text- und Hörverständnis) Sprachkompetenzen. Dazu werden Wortschatz, Grammatik und Aussprache gezielt trainiert. Ergänzend erlernen die Schülerinnen und Schüler sprachliche Lernstrategien, um ihre Selbstständigkeit im Sprachgebrauch zu stärken.
Neben der sprachlichen Förderung legt das Gymnasium Remigianum besonderen Wert auf die soziale und schulische Integration der Lernenden. Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt, ihre individuellen Fähigkeiten über den sprachlichen Bereich hinaus gefördert.
Ein zentrales Entwicklungsziel besteht in der noch stärkeren Verzahnung der Willkommensklasse mit dem Regelunterricht. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Fach- und DaZ-Lehrkräften soll die Integration weiter verbessert und die sprachliche Förderung bestmöglich auf die fachlichen Anforderungen abgestimmt werden. Dies soll künftig in der Fachkonferenzarbeit noch stärker in den Blick genommen werden.
[1] Siehe gesondertes Konzept ERSTFÖRDERUNG.
III. Erziehung, Werte, Normen
1. Mitwirkung, Partizipation und Kooperation
Mitwirkung, Partizipation und Kooperation sind zentrale Prinzipien der Schulentwicklung am Gymnasium Remigianum. Diese Aspekte sind in unserem Leitbild verankert und werden im Schulalltag aktiv gelebt. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW fördern wir eine Schulkultur, in der alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, Entscheidungsprozesse mitgestalten und das Schulleben aktiv prägen können.
Partizipation wird bei uns als grundlegendes Prinzip der Schulorganisation verstanden. Sie zeigt sich insbesondere durch die wöchentlichen Jours fixes zwischen der Schulleiterin und den Schülersprechern. Diese festen Gesprächstermine bieten den Schülerinnen und Schülern eine direkte Möglichkeit, ihre Anliegen einzubringen, Probleme zu thematisieren und aktiv an schulischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Diese strukturierte Beteiligung ermöglicht es, wichtige Impulse aus der Schülerschaft aufzunehmen und in die Schulentwicklung einfließen zu lassen.
Darüber hinaus gibt es regelmäßige Schülerbefragungen zu unterrichtlichen und organisatorischen Themen sowie schulweite Beteiligungsformate wie thematische Workshops. Auch in Fachkonferenzen werden Schülerinnen und Schüler aktiv eingebunden.
Die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz sind zentrale Gremien der Mitwirkung für Eltern. Sie beraten über schulische Entwicklungen und nehmen aktiv Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Auch Fachkonferenzen, die Steuergruppe und Arbeitskreise sind neben Lehrkräften mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern besetzt, um deren Perspektiven in die Schulgestaltung einzubringen.
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist ein wichtiger Baustein unseres schulischen Profils und entspricht den Anforderungen des Referenzrahmens Schulqualität NRW im Bereich „Öffnung von Schule“. Unsere Kooperationen mit Wirtschaft, Hochschulen, kulturellen Institutionen und Vereinen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und berufliche Perspektiven zu entwickeln.
Ein Beispiel ist die enge Zusammenarbeit mit der Musikschule Borken. Im MINT-Bereich kooperieren wir mit regionalen Unternehmen wie Evonik oder der Westfälischen Hochschule Bocholt, um praxisorientierte Projekte und Praktika anzubieten. Zudem nehmen wir als Europaschule an grenzüberschreitenden Projekten mit internationalen Kooperationspartnern teil.
Am Gymnasium Remigianum tragen alle Akteure gemeinsam Verantwortung für die Schulentwicklung: Unsere Schule sieht sich als lernende Organisation, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. In der Steuergruppe „Globale Schulentwicklung“ arbeiten Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Schulentwicklungsprozessen. Hier werden Entwicklungsziele festgelegt, evaluiert und weiterentwickelt. Das Gymnasium Remigianum lebt Mitwirkung, Partizipation und Kooperation als wesentliche Elemente der Schulqualität. Die enge Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und externen Partnern schafft eine Schulgemeinschaft, die aktiv an der Gestaltung der Schule mitwirkt und damit eine nachhaltige Schulentwicklung sichert.
2. Informationswege
Am Gymnasium Remigianum legen wir großen Wert auf transparente und effektive Kommunikationswege zwischen der Schulleitung, den Lehrkräften, den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern. Eine klare und offene Kommunikation ist für uns die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit und eines gelingenden Miteinanders. Unser Kommunikationskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Referenzrahmens Schulqualität NRW und stellt sicher, dass alle Beteiligten zeitnah, zuverlässig und adressatengerecht informiert werden.
Um eine kontinuierliche und klare Kommunikation sicherzustellen, erhalten alle Lehrkräfte wöchentlich die RemiINFO, eine digitale Informations-Mail mit relevanten Mitteilungen zu schulischen Abläufen, Konferenzen, Veranstaltungen und organisatorischen Themen. Diese regelmäßige Information hilft, die Woche zu planen und sicherzustellen, dass alle auf dem aktuellen Stand sind. Die Schulleitung ist immer spontan ansprechbar. Für ausführlichere Gespräche können über das Schulbüro individuelle Termine vereinbart werden, sodass genügend Zeit für persönliche Anliegen bleibt.
An unserer Schule ist die Pflege eines sog. systemischen Gedächtnisses besonders wichtig, da wir eine große Schule sind: Es finden viele Abläufe parallel statt, so dass sich ein besonderer Dokumentationsbedarf ergibt. Auch neue Lehrkräfte sowie Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Abordnungen und Elternzeit stehen vor der Herausforderung, sich schnell in bestehenden Strukturen und Absprachen einzuarbeiten. Dazu haben wir das REMILexikon entwickelt, ein digitales Nachschlagewerk, das von Lehrkräften für Lehrkräfte geschrieben wird. Es dient als unser systemisches Gedächtnis. Hier werden alle wesentlichen Absprachen, Prozesse und organisatorischen Regelungen dokumentiert und gepflegt. So können sich neue Teammitglieder ebenso wie langjährige Kolleginnen und Kollegen jederzeit über aktuelle Abläufe informieren. Das REMILexikon trägt dazu bei, dass Informationen nicht verloren gehen und alle auf eine gemeinsame Wissensbasis zugreifen können. Damit stärkt es die Verlässlichkeit und Transparenz unserer Schulkultur und unterstützt eine strukturierte Schulorganisation. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW leistet es insbesondere im Bereich Schulführung und Schulmanagement einen wichtigen Beitrag zur effektiven Steuerung und Organisation unserer Schule.
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt unseres Schullebens, sie sind das Herzstück. Deshalb ist eine direkte und offene Kommunikation mit ihnen besonders wichtig. Wir pflegen bei aller Rollenklarheit einen Kontakt auf Augenhöhe. Auch die Schulleiterin unterstützt durch Gespräche auf den Fluren, in den Pausen oder zu Schulbeginn eine Atmosphäre des Vertrauens. Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich gehört fühlen und die Möglichkeit haben, Anliegen direkt vorzubringen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler ist wichtig für das Gelingen der Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus. Daher setzen wir auf eine klare und transparente Informationspolitik. Über das digitale Tool „Elternnachricht“ versendet die Schulleitung regelmäßig Elternbriefe mit wichtigen Informationen zu schulischen Entwicklungen, Terminen und Veranstaltungen.
Zusätzlich stellen die Klassen- und Stufenleitungen sicher, dass alle wichtigen Informationen die Eltern rechtzeitig und vollständig erreichen. Die Eltern werden offen über relevante schulische Themen informiert und können sich bei individuellen Anliegen jederzeit an die zuständigen Lehrkräfte wenden. Unsere Schulhomepage enthält stets aktuelle Informationen zu Ansprechpartnern und dem schulischen Kommunikationskonzept[1]
Das Gymnasium Remigianum informiert neben der Schulgemeinschaft auch die Öffentlichkeit über wichtige schulische Entwicklungen. Neben der regelmäßigen Aktualisierung der Schulhomepage werden Neuigkeiten und Veranstaltungen über unseren Instagram-Account geteilt. Hier erhalten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte Einblicke in besondere Ereignisse und Projekte des Schulalltags.
Darüber hinaus gibt es eine kontinuierliche Berichterstattung in der Borkener Zeitung, um schulische Aktivitäten und Erfolge zu präsentieren. Gelegentlich wird auch im Lokalfernsehen oder Lokalrundfunk über relevante Themen berichtet So wird die Schule als fester Bestandteil der Bildungslandschaft in der Region sichtbar.
3. Demokratiebildung und Kultur des Umgangs
Am Gymnasium Remigianum verstehen wir Demokratiebildung als eine grundlegende Aufgabe schulischer Erziehung. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW fördern wir eine Schulkultur, die von Partizipation, Mitbestimmung und Verantwortungsübernahme geprägt ist (siehe auch oben). Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen und sich aktiv in demokratische Prozesse einzubringen.
Ein zentrales Element unserer Demokratiebildung ist die Teilnahme an der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der wir seit 2016 angehören. In der AG „Schule mit Courage“ setzen sich Schülerinnen und Schüler aktiv für Vielfalt, Respekt und ein diskriminierungsfreies Miteinander ein. Jährlich werden Aktionen wie die Gedenkveranstaltung am 9. November, die Internationale Woche gegen Rassismus oder der Gedenktag „Weiße Rose“ durchgeführt.
Um demokratisches Bewusstsein und politische Bildung zu stärken, führen wir regelmäßig das Format „Mit Demokratie zum Ziel: Politikerinnen und Politiker in der Schule“ durch. Dabei kommen Abgeordnete verschiedener politischer Ebenen mit unseren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch, um über demokratische Entscheidungsprozesse und ihre persönliche politische Arbeit zu berichten.
Ein weiterer fester Bestandteil unseres Schulcurriculums ist das Programm „Jugend debattiert“, das seit 2016 in den Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialwissenschaften verankert ist. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II nehmen jährlich an Schul- und Regionalwettbewerben teil und erlernen so die Grundlagen der argumentativen Auseinandersetzung und Meinungsbildung. Zur weiteren Vertiefung wird die Einführung eines Projektkurses „Jugend debattiert“ angestrebt.
Demokratische Mitbestimmung wird auch durch die Juniorwahl gefördert, die im Rahmen aller Landtags-, Bundestags- und Europawahlen für die gesamte Schülerschaft durchgeführt wird. So erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich frühzeitig mit Wahlen, politischen Programmen und demokratischen Entscheidungsprozessen auseinanderzusetzen.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist ein essenzieller Bestandteil unserer Demokratiebildung. Als Schulgemeinschaft nehmen wir unsere Verantwortung wahr, aus der Geschichte zu lernen, indem wir aktiv eine gelebte Erinnerungskultur pflegen. Jährlich finden Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz und Bergen-Belsen statt, an denen Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und 11 teilnehmen. Diese Fahrten ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, den Verbrechen an der Menschlichkeit und der Bedeutung von Verantwortung und Zivilcourage in der Gegenwart.
Die Fahrten werden durch vorbereitende und nachbereitende Einheiten begleitet, die historische Hintergründe aufarbeiten und die Reflexion über die Erlebnisse vor Ort fördern. Die Teilnehmenden tragen ihre Erfahrungen in die Schulgemeinschaft hinein, indem sie über ihre Eindrücke berichten und Impulse für weitere Projekte im Bereich der Demokratiebildung setzen.
Mit diesen Maßnahmen setzt das Gymnasium Remigianum ein klares Zeichen für gelebte Demokratie, die Auseinandersetzung mit Geschichte und die aktive Verantwortung für eine offene, tolerante Gesellschaft.
4. Geschlechtersensible Bildung
Die Geschlechtersensible Bildung ist vom Land NRW als Querschnittsaufgabe für alle Schulen und Fächer verpflichtend. Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit und geschlechtliche Vielfalt zu schaffen, Stereotype aktiv zu hinterfragen und allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine gleichwertige Teilhabe zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl die Unterrichtsgestaltung als auch konkrete Maßnahmen im Schulalltag, um Diskriminierung entgegenzuwirken und eine respektvolle Schulkultur zu fördern.
Lehrkräfte des Gymnasium Remigianum nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Lehrkräftekonferenzen zur geschlechtersensiblen Pädagogik teil. Dabei werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Materialien von QUA-LiS NRW und der Bezirksregierung Münster genutzt, um den Unterricht diversitätssensibel zu gestalten. Alle Fachschaften sind dazu angehalten, Inhalte zu geschlechtlicher Vielfalt, Gleichberechtigung und Rollenbildern gezielt in den Unterricht einzubinden, insbesondere in den Fächern Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften und Biologie.
Ein wichtiger Baustein ist die konsequente geschlechtergerechte Sprache. In offiziellen Dokumenten, Elternbriefen, schulischen Mitteilungen und auf der Homepage wird auf eine inklusive Formulierung geachtet, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen. Hinweisschilder auf dem Schulgelände werden sukzessive entsprechend angepasst, sodass sich alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte angesprochen fühlen.
Ein zentraler Akteur in der Umsetzung ist die Diversität-AG, die mit verschiedenen Aktionen zur Sensibilisierung der Schulgemeinschaft für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beiträgt. Ein besonders sichtbares Projekt ist der queere Adventskalender, der in der Vorweihnachtszeit über bekannte queere Persönlichkeiten berichtet.
Sollte es zu diskriminierenden oder abwertenden Äußerungen oder Handlungen kommen, werden konkrete pädagogische Maßnahmen eingeleitet. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam und der Schulsozialarbeit erhalten betroffene Schülerinnen und Schüler Unterstützung, während mit den beteiligten Personen klärende Gespräche geführt und pädagogische Maßnahmen wie Reflexionsaufgaben oder verpflichtende Workshops umgesetzt werden. Ziel ist es, nicht nur auf Vorfälle zu reagieren, sondern durch kontinuierliche Bildungsarbeit ein Klima der Akzeptanz und Offenheit zu schaffen.
Ein fester Bestandteil der geschlechtersensiblen Bildungsarbeit ist zudem der Girls’ & Boys’ Day, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bewusst Berufe erkunden, die gesellschaftlich noch immer geschlechtsspezifisch geprägt sind. Durch die aktive Auseinandersetzung mit traditionellen Rollenbildern und eigenen beruflichen Interessen sollen sie ermutigt werden, ihre berufliche Zukunft unabhängig von Geschlechterklischees zu gestalten.
Um die geschlechtersensible Schulentwicklung langfristig zu verankern, sind für die kommenden Jahre folgende Maßnahmen geplant: Die systematische Verankerung des Themas in den Curricula aller relevanten Fächer, die Institutionalisierung der Diversität-AG als feste Anlaufstelle für geschlechtliche Vielfalt sowie die regelmäßige Evaluation und Weiterentwicklung der Maßnahmen.
Unser Ziel ist es, dass das Gymnasium Remigianum eine Schule ist, die Vielfalt als Bereicherung versteht. Hier sollen sich alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung – gleichermaßen akzeptiert, wertgeschätzt und unterstützt fühlen.
5. Übergangsmanagement von der Primarstufe zur Erprobungsstufe
Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium Remigianum ist ein entscheidender Schritt in der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Um diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurde in den letzten Jahren ein umfassendes Übergangsmanagement entwickelt, das in enger Zusammenarbeit mit den abgebenden Grundschulen stetig weiterentwickelt wird. Dieses Schulentwicklungsvorhaben wurde von zahlreichen engagierten Akteuren aus Schulleitungen, Lehrkräften, Elternvertretung aus abgebenden Grundschulen und dem Gymnasium Remigianum aktiv mitgestaltet. Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit war die Anpassung des Raumkonzepts für die Erprobungsstufe sowie die gezielte Verbesserung der Ausstattung, um den spezifischen Bedürfnissen der neu ankommenden Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.
Bereits im Vorfeld des Schulwechsels von der Grundschule gibt es verschiedene Formate, um eine frühzeitige Verbindung zwischen den Grundschulen und dem Gymnasium Remigianum zu schaffen. Dazu gehören gemeinsame Dienstbesprechungen mit den Grundschulen, den weiterführenden Schulen und dem Schulträger, in denen schulische Abläufe abgestimmt, Termine für schulinterne Fortbildungstage und bewegliche Ferientage koordiniert und Fragen der Schulentwicklung gemeinsam beraten werden. Eine besondere Rolle spielt die neu eingeführte Übergangskonferenz, die einmal jährlich mit allen Grundschulen und allen weiterführenden Schulen in Borken stattfindet. Diese Konferenz, die jedes Jahr von einer anderen weiterführenden Schule organisiert wird, bietet die Möglichkeit, Erfahrungen und Herausforderungen beim Schulwechsel systematisch auszuwerten, bewährte Maßnahmen zu reflektieren und neue Impulse für eine bestmögliche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
Nach der Anmeldung am Gymnasium Remigianum beginnt die gezielte Vorbereitung auf den Schulwechsel. Der Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien ermöglicht es den zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern, erste Kontakte zu knüpfen, ihre Klassenleitungen kennenzulernen und das Schulgebäude spielerisch zu erkunden. Zu Schuljahresbeginn starten sie mit speziellen Klassenleitungstagen, die ihnen Orientierung bieten, das Ankommen erleichtern und durch gemeinschaftsbildende Maßnahmen den Grundstein für ein positives Klassenklima legen. Die Klassenleitungen sind als feste Bezugspersonen mit vielen Stunden in ihrer Klasse eingesetzt, um Kontinuität zu schaffen und die Schülerinnen und Schüler in ihrer neuen Lernumgebung bestmöglich zu begleiten. Die in der Grundschule entwickelten Kompetenzen werden gezielt weitergeführt und um gymnasiale Lernformen ergänzt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung des eigenständigen Lernens, das schrittweise aufgebaut wird.
Zur Unterstützung der sozialen Integration tragen verschiedene Maßnahmen bei, die über das erste Schuljahr hinweg kontinuierlich begleitet werden. Ein etabliertes Patenprogramm mit älteren Schülerinnen und Schülern sorgt für eine direkte Ansprechmöglichkeit im Schulalltag und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Durch das Programm „Starke Kinder – Starke Klassengemeinschaft“ werden soziale Kompetenzen gezielt gefördert, während gemeinsame Aktivitäten wie die Klassenfahrt oder Wandertage zur Festigung der Klassengemeinschaft beitragen.
Das Übergangsmanagement am Gymnasium Remigianum wird regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt. Der enge Austausch mit den Grundschulen, die strukturierte Reflexion durch die Übergangskonferenzen und die Anpassung schulischer Strukturen haben dazu geführt, dass der Wechsel auf das Gymnasium als gut vorbereitet und unterstützend erlebt wird. Das Gymnasium Remigianum versteht diesen Prozess als eine ständige zentrale Aufgabe der Schulentwicklung, um allen neuen Schülerinnen und Schülern einen gelungenen Start in ihre gymnasiale Laufbahn zu ermöglichen.
6. Studien- und Berufsorientierung
Die systematische Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf ihre berufliche Zukunft ist ein zentraler Bestandteil der Bildungsarbeit am Gymnasium Remigianum.[2]Die Schule verfolgt das Ziel, eine fundierte und praxisnahe Studien- und Berufsorientierung zu gewährleisten, die sich an den individuellen Interessen und Stärken der Lernenden orientiert. Durch ein breit aufgestelltes Konzept, das sowohl unterrichtliche als auch außerunterrichtliche Maßnahmen umfasst, erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre beruflichen Perspektiven frühzeitig zu erkunden und fundierte Entscheidungen für ihren weiteren Werdegang zu treffen.
Ab der Jahrgangsstufe 9 setzt das Gymnasium Remigianum das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) konsequent um. Die Potenzialanalyse unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre individuellen Stärken und Interessen zu erkennen, während die anschließende Berufsfelderkundung erste praxisnahe Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche ermöglicht. Ein zentraler Bestandteil der Berufsorientierung ist das zweiwöchige Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 10, das den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich intensiv mit einem konkreten Berufsfeld auseinanderzusetzen und wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln.
Die in der Mittelstufe gewonnenen Erkenntnisse werden in der Einführungsphase der Oberstufe vertieft und durch individuelle Beratungsgespräche ergänzt.
In der Oberstufe wird die Studien- und Berufsorientierung weiter ausgebaut. Die jährlichen Berufsorientierungstage bieten eine Vielzahl von Workshops, Vorträgen und individuellen Beratungsmöglichkeiten. Besonders wertvoll ist hierbei die enge Einbindung ehemaliger Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die aus erster Hand über ihre beruflichen Werdegänge berichten und authentische Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Studiengänge gewähren. Zudem nimmt das Gymnasium Remigianum regelmäßig an Formaten wie dem „Azubi-Speeddating“ und der „Nacht der Ausbildung“ teil, die den direkten Austausch mit Unternehmen und Hochschulen in der Region ermöglichen.
Neu in das Konzept der Studien- und Berufsorientierung integriert wurde das Talentscouting NRW. Dieses Programm bietet besonders engagierten und talentierten Schülerinnen und Schülern eine langfristige, individuelle Begleitung durch professionelle Talentscouts, die ihnen bei der Entwicklung ihrer Bildungs- und Berufswege beratend zur Seite stehen. Darüber hinaus ist das Gymnasium Remigianum eine von wenigen Schulen, die gemeinsam mit der Universität Münster, Fachbereich Erziehungswissenschaften, einen umfassenden Evaluationsprozess zur Studien- und Berufsorientierung durchführt. Dieser Prozess, an dem sowohl die Schulleitung als auch die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Mittel- und Oberstufe beteiligt sind, soll die bestehenden Maßnahmen weiter optimieren und auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickeln.
Die Schule ist aktiv in das Bildungsnetzwerken des Kreises Borken eingebunden und arbeitet eng mit der Agentur für Arbeit sowie zahlreichen regionalen Unternehmen und Hochschulen zusammen. Schülerinnen und Schüler haben regelmäßig die Möglichkeit, individuelle Beratungsgespräche direkt in der Schule wahrzunehmen und sich gezielt auf Bewerbungsprozesse und Studienwahlentscheidungen vorzubereiten.
7. Beratung und Kinderschutz
Die Beratung am Gymnasium Remigianum ist ein zentraler Bestandteil der schulischen Unterstützungsstruktur.[3] Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, sie in schulischen und persönlichen Herausforderungen zu unterstützen und allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft qualifizierte Ansprechpersonen zur Seite zu stellen. Gleichzeitig trägt die Beratung dazu bei, eine Kultur der Achtsamkeit, Prävention und Partizipation zu fördern, die das schulische Miteinander stärkt.
Das Beratungsteam am Gymnasium Remigianum setzt sich aus sechs speziell ausgebildeten Lehrkräften sowie einer Schulseelsorgerin zusammen. Diese Fachkräfte stehen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen bei schulischen, persönlichen oder sozialen Fragestellungen beratend zur Seite. Regelmäßige Fortbildungen, gemeinsame Teamtage und kontinuierlicher fachlicher Austausch gewährleisten, dass die Beratungspraxis aktuellen pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen entspricht. Die Sitzungen des Beratungsteams finden in festen Intervallen statt, um Fallbesprechungen durchzuführen, Beratungskonzepte weiterzuentwickeln und schulische Unterstützungsstrukturen bedarfsgerecht zu optimieren.
Ein zentraler Bestandteil der Beratung ist das schulinterne Schutzkonzept, das als integrativer Bestandteil des Beratungskonzepts verankert ist. Es beinhaltet präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des Kinderschutzes sowie klare Handlungsleitlinien für den Umgang mit Verdachtsfällen oder akuten Gefährdungslagen. Lehrkräfte werden regelmäßig für den sensiblen Umgang mit Kindeswohlgefährdung geschult, sodass sie frühzeitig Unterstützung anbieten und in kritischen Situationen angemessen reagieren können. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass der Schutz der Schülerinnen und Schüler nicht nur als theoretisches Konzept existiert, sondern aktiv im Schulalltag gelebt wird.
Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit mit der Regionalen Schulberatung, die sich als wertvolle Unterstützung der schulinternen Beratung etabliert hat. In herausfordernden Einzelfällen ermöglicht sie eine vertiefte diagnostische und pädagogische Hilfe, während sie gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur professionellen Fortbildung des Beratungsteams leistet. Regelmäßig absolvieren Lehrkräfte des Gymnasium Remigianum dort die Ausbildung zu Beratungslehrkräften. Diese kontinuierliche Professionalisierung stärkt nicht nur die individuelle Qualifikation der Lehrkräfte, sondern trägt maßgeblich zur systemischen Weiterentwicklung der Schule als lernende Organisation bei.
Die Entwicklungsarbeit im Bereich Beratung und Schutzkonzept konzentriert sich auf die fortlaufende Aktualisierung und Konsolidierung der bestehenden Strukturen. Besondere Schwerpunkte liegen in der Weiterqualifizierung der Beratungslehrkräfte, der Evaluierung und Anpassung des Schutzkonzepts sowie der Weiterentwicklung des Teamtags in der Jahrgangsstufe 8, der gezielt auf soziale Kompetenzen, Konfliktbewältigung und die Förderung eines respektvollen Schulklimas ausgerichtet ist.
Wir wollen durch eine kontinuierliche Reflexion, Anpassung und Erweiterung der Beratungsstrukturen sicherstellen, dass alle am Schulleben Beteiligten in ihren individuellen Herausforderungen bestmöglich unterstützt werden und eine Schule erleben, die nicht nur Lern- sondern auch Lebensraum ist.
8. Bildung für nachhaltige Entwicklung am Remigianum
Das Gymnasium Remigianum sieht sich als eine Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln möchte, wie nachhaltiges und ressourcenschonendes Leben aussieht, in Übereinstimmung mit dem Referenzrahmen Schulqualität NRW und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dieses Engagement wurde durch die Auszeichnung als “Schule der Zukunft” in der höchsten Stufe anerkannt.
Im Schuljahr 2021/2022 entschied sich die Schulgemeinschaft, die Prinzipien nachhaltiger Bildung stärker zu institutionalisieren. Die Schulkonferenz beschloss mit der Teilnahme am Landesprogramm “Schule der Zukunft”, unser Gymnasium als Schule für nachhaltige Bildung und Entwicklung zu qualifizieren. Dieser Prozess führte zur systematischen Integration von BNE-Themen in den Unterricht, insbesondere in den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, und zur Initiierung fächerübergreifender Projekte. Seitdem ist der Aspekt der Bildung für Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteilt unseres Schulalltags geworden, der sich in immer mehr Bereichen manifestiert und noch ausgebaut wird.
Die Schulgemeinschaft engagiert sich in vielfältigen Projekten und Kooperationen mit Netzwerkpartnern. So wurde das Gymnasium Remigianum zweimal mit dem Klimaschutzpreis des Kreises Borken ausgezeichnet, was das außergewöhnliche Engagement im Bereich nachhaltiger Bildung und Entwicklung unterstreicht. Ein Meilenstein war auch ein Fit-for-us-Tag zum Thema “Nachhaltiges Leben – Energiesparen“, an dem die gesamte Schulgemeinschaft teilnahm. Im September ist das Remigianum stets ein wichtiger Akteur um Rahmen der kreisweiten Klimawochen.
Im Bereich der Mobilität setzt die Schule ebenfalls Maßstäbe: Regelmäßig gehen die Schülerinnen und Schüler als Stadtsieger im Schulradeln hervor und erhielten 2024 den Preis des Regierungspräsidenten für ihre herausragenden Leistungen. Klimaschutz und Umdenken im Bereich der Mobilität werden mit dem Schulradeln auch in die Elternhäuser getragen.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich BNE wird durch die enge Zusammenarbeit mit dem Schulträger, insbesondere die Klimaschutzabteilung der Stadt Borken, mit dem Netzwerk “Schule der Zukunft im Kreis Borken” und weiteren Partnern unterstützt. Diese Kooperationen ermöglichen es, aktuelle Themen der Nachhaltigkeit in den Schulalltag zu integrieren und gemeinsame Aktionen durchzuführen. Die Auszeichnung durch Schulministerin Dorothee Feller im Februar 2025 für die Arbeit im Rahmen des Netzwerks für nachhaltige Entwicklung im Kreis Borken unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung von BNE am Gymnasium Remigianum.
Durch diese vielfältigen Aktivitäten und Auszeichnungen wird das Gymnasium Remigianum seinem Anspruch gerecht, den Schülerinnen und Schülern ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Leben nahezubringen und sie zu verantwortungsbewussten Gestaltern ihrer Zukunft zu entwickeln.
9. Schulleben
Schule ist mehr als Unterricht. In diesem Sinne wird Gemeinschaft großgeschrieben. Das spiegelt sich in zahlreichen Veranstaltungen und Traditionen wider, die das Schulleben bereichern und den Gemeinschaftssinn stärken.
Ein besonderes Highlight ist das jährliche Schüler-Lehrer-Fußballturnier zum Halbjahreswechsel. Dieses sportliche Ereignis fördert den Teamgeist und ist Plattform für informelle Begegnungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Die Schülerschaft fiebert diesem Turnier teilweise entgegen, und es trägt maßgeblich zur Stärkung des Wir-Gefühls bei.
Die Schülervertretung (SV) engagiert sich mit kreativen Aktionen wie der Nikolaus- und der Valentinsaktion. Bei der Nikolausaktion werden Schokoladennikoläuse verteilt, während am Valentinstag Rosen als Zeichen der Wertschätzung und Freundschaft überreicht werden. Diese Initiativen fördern den sozialen Zusammenhalt und schaffen eine warme, unterstützende Atmosphäre innerhalb der Schulgemeinschaft.
In Abständen von einigen Jahren organisiert das Gymnasium Remigianum jeweils ein Schulfest auf dem Schulhof. Dieses Fest bietet allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen und die Vielfalt der Schule zu erleben. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die Identifikation mit der Schule.
Der noch junge Kulturtag “Rem(mi)-Demmi” ist ein weiteres Beispiel für das vielfältige Schulleben. An diesem Tag präsentieren Schülerinnen und Schüler ihre kreativen Talente in den Bereichen Musik, Theater und Kunst. Diese Veranstaltung fördert die kulturelle Bildung und bietet eine Bühne für individuelle Ausdrucksformen.
Die MINT-Gala würdigt die Leistungen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Sie zeigt das Engagement der Schule in diesen Fachbereichen und motiviert Schülerinnen und Schüler, sich in diesen Feldern zu engagieren.
Der “Tag der Wertschätzung” ist ein fester Bestandteil des Schuljahres. An diesem Tag werden besondere Leistungen und das Engagement von Mitgliedern der Schulgemeinschaft gewürdigt, was zur Förderung einer positiven Schulkultur beiträgt.
Klassenfahrten und Schulfahrten, wie die traditionelle Skifahrt nach Luttach in Südtirol, fördern das soziale Lernen und stärken den Zusammenhalt innerhalb der Klassen. Solche gemeinsamen Erlebnisse tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei und schaffen nachhaltige Erinnerungen an die Schulzeit.
In den unteren Klassenstufen sind Klassenfeste üblich, die den Gemeinschaftssinn stärken und den Austausch zwischen Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern fördern. Diese informellen Treffen tragen zu einer positiven Lernatmosphäre bei.
Auch das Lehrerkollegium pflegt eine aktive Gemeinschaftskultur. Optionale Veranstaltungen wie “Remi-on-Tour”, eine zweitägige Fahrt in korrekturarmen Zeiten, fördern den Teamgeist und den kollegialen Austausch und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Kleine Weihnachtsfeiern und das “Off-Boarding” beim Eintritt in den Ruhestand sind Ausdruck der Wertschätzung innerhalb des Kollegiums. Der gemeinsame Start in die Sommerferien am Vorabend der Ferien bietet Gelegenheit, das vergangene Schuljahr gemeinsam Revue passieren zu lassen und gestärkt in die Ferien zu gehen.
10. Gesundheit und Arbeitsschutz am Remigianum
Das Gymnasium Remigianum hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um ein sicheres und gesundes Umfeld für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu gewährleisten. Im Einklang mit den Vorgaben des Referenzrahmens Schulqualität NRW werden Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention systematisch weiterentwickelt und regelmäßig unter Leitung des Sicherheitsbeauftragten evaluiert.
Die Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem BAD ist ein fester Bestandteil des schulischen Arbeitsschutzes. Jährliche Treffen und Begehungen dienen der Analyse bestehender Strukturen sowie der Identifikation und Umsetzung von Verbesserungsmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist die fortlaufende Anpassung der Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte: Ein neuer, modern ausgestatteter Lehrkräftearbeitsraum sowie zusätzliche Beratungsräume ermöglichen eine verbesserte Arbeitsumgebung und tragen zur Entlastung des Kollegiums bei. Ergänzend dazu nimmt das Remigianum regelmäßig an Erhebungen mittels COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) teil, um psychosoziale Belastungen zu erfassen und gezielt Maßnahmen zur Gesundheitsförderung abzuleiten.
Ein weiterer zentraler Aspekt des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ist der umfassende Brandschutz. Am Gymnasium Remigianum finden zweimal jährlich Räumungsübungen statt, die gewährleisten, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft im Ernstfall schnell und geordnet handeln können. Darüber hinaus werden alle fünf Jahre Lehrkräfte zu Brandschutzhelfern ausgebildet, um die Sicherheit im Schulalltag weiter zu erhöhen.
Bereits seit 2002 leistet der Schulsanitätsdienst einen wertvollen Beitrag zur Ersten Hilfe und Unfallprävention. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis Q2 werden in der wöchentlichen Schulsanitätsdienst-AG zu Ersthelferinnen und Ersthelfern ausgebildet. Dabei steht nicht nur das Erlernen von medizinischem Wissen im Mittelpunkt, sondern auch die Entwicklung von Einfühlungsvermögen, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein. Der Schulsanitätsdienst ist dabei kein Einzelprojekt, sondern eine eingespielte Gruppe, die durch regelmäßige Treffen ihre Einsätze reflektiert und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders wichtig ist der präventive Ansatz: Neben der direkten Hilfeleistung setzen sich die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter auch mit der Vermeidung von Unfällen auseinander. Ihr Engagement entlastet zudem das Kollegium, da im Falle eines medizinischen Notfalls geschulte Schülerinnen und Schüler unmittelbar Erste Hilfe leisten und bei Bedarf den Rettungsdienst hinzuziehen.
Das Gymnasium Remigianum verfügt zudem über ein erfahrenes Krisenteam, das in Prävention, Intervention und Nachsorge schulischer Krisen geschult ist. Die Mitglieder haben an spezifischen Schulungen des Landes NRW teilgenommen und arbeiten auf Basis des Notfallordners der Unfallkasse NRW. Im Krisenfall trifft sich das Team umgehend, strukturiert die Maßnahmen und leitet die Schulgemeinschaft sicher durch herausfordernde Situationen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Bereichs bleibt ein wichtiges Ziel der Schulentwicklungsarbeit. Geplant sind eine Neustrukturierung der Arbeitsbereiche innerhalb des Krisenteams sowie eine engere Verzahnung mit anderen Beratungs- und Präventionsangeboten.
Schwerpunkte der mittelfristigen Entwicklungsarbeit bestehen zudem in der gezielten Ausweitung der Anzahl der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter.
Gymnasium Remigianum – eine gesunde Schule aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler
Trotz und gerade wegen seiner Größe stellt das Gymnasium Remigianum das Wohl jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers in den Mittelpunkt. Die individuelle Betreuung beginnt mit verlässlichen Klassenlehrerteams in der Erprobungs- und Mittelstufe und setzt sich in der Oberstufe mit speziell ausgebildeten Beratungslehrkräften fort. Besonders in der Jahrgangsstufe 5 unterstützt das SKSKG-Programm die Entwicklung einer starken Klassengemeinschaft und eines Zugehörigkeitsgefühls zur Schule.
Gesundheitsförderung spielt eine zentrale Rolle: Neben Programmen zur Alkohol- und Drogenprävention sowie Verkehrserziehung profitieren die Schülerinnen und Schüler von einem bewährten Patensystem und dem Konzept Schüler helfen Schülern, das Unterstützung durch Mitschüler ermöglicht. Gemeinschaftserlebnisse wie der Fit-for-us-Tag stärken den Zusammenhalt und die Identifikation mit der Schule.
Das Remigianum bietet zudem ein umfassendes Betreuungsangebot. Durch das konsequente Vertretungskonzept fällt in der Sekundarstufe I kein Unterricht aus, sodass jederzeit Lehrkräfte ansprechbar sind. In den Pausen und Nachmittagsstunden stehen eine Vielzahl an Freizeit- und Förderangeboten, von Sportkursen über Musik-Schnupperkurse bis hin zur Hausaufgabenbetreuung, zur Verfügung. Die Rhythmisierung des Schultags mit Doppelstunden und begrenztem Nachmittagsunterricht sorgt für eine ausgewogene Balance zwischen Anstrengung und Entspannung.
Vielfältige Beratungsmöglichkeiten, sei es durch Klassen- und Beratungslehrkräfte oder die Schulseelsorgerin, gewährleisten eine individuelle Begleitung in schulischen und persönlichen Belangen. Zudem bietet das Gymnasium Remigianum den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten zur Mitgestaltung: Ob in der Schülervertretung, dem Schulentwicklungsgremium oder als Medienscouts – sie können aktiv ihre Lernumgebung mitgestalten und ihre Selbstwirksamkeit erfahren.
Gymnasium Remigianum – eine gesunde Schule aus Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer
Auf die Lehrkräfte bezogen wird am Gymnasium Remigianum das schulische Handeln der Lehrkräfte durch feste Teamstrukturen so weit wie möglich entlastet. Klassenleitungs- und Klassenteams organisieren gemeinsam den Unterricht, planen und terminieren Klassenarbeiten als Parallelarbeiten, was zu einer deutlichen Reduzierung der individuellen Arbeitsbelastung führt und den kollegialen Austausch fördert. Auf schulorganisatorischer Ebene können Lehrkräfte ihre Wünsche hinsichtlich Unterrichtsverteilung einbringen, sodass persönliche Schwerpunkt-setzungen ermöglicht werden. Die Kommunikation wird allgemein als wertschätzend empfunden. Das Teilzeitkonzept sorgt dafür, dass Lehrkräfte mit einer 17-Stunden-Verpflichtung einen freien Tag pro Woche erhalten und an Elternsprechtagen in reduzierter Sprechzeit zur Verfügung stehen. Neue Kolleginnen und Kollegen werden durch eine umfassende Informationsmappe (REMI-Lexikon) sowie individuelle Einführungen in den aktuellen Stand der Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt, wodurch Unsicherheiten abgebaut werden. Im besonderen Fall einer Schwangerschaft werden umgehend Maßnahmen zum Schutz von Mutter und Kind ergriffen, einschließlich arbeitsmedizinischer Beratung und gegebenenfalls eines Beschäftigungsverbots. Aktuell ist ein Bedarf nach Fortbildung im Bereich der Lehrergesundheit ermittelt worden, der möglichst kurzfristig bedient werden soll. Diese vielfältigen Maßnahmen tragen dazu bei, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich bei aller Herausforderung Lehrkräfte wohlfühlen und ihre berufliche Tätigkeit nachhaltig ausüben können.
[1] siehe gesondertes Konzept KOMMUNIKATION im Anhang. Die Ansprechpartnerliste findet sich jeweils aktualisiert auf der Homepage.
[2] Siehe gesonderte Übersicht KAOA
[3] Lesen Sie dazu unser ausführliches BERATUNGS- UND SCHUTZKONZEPT .
IV. Professionalisierung
1. Ausbildung von Lehrkräften
Die Ausbildung von Lehrkräften am Gymnasium Remigianum hat einen hohen Stellenwert und wird von der gesamten Schulgemeinschaft getragen. Alle Lehrkräfte engagieren sich gerne in der Ausbildung, um angehenden Kolleginnen und Kollegen eine fundierte Vorbereitung auf den Beruf zu ermöglichen. Grundlage unseres Ausbildungskonzepts ist der Referenzrahmen Schulqualität NRW, insbesondere mit Fokus auf die Bereiche „Lehren und Lernen“, „Schulkultur“ sowie „Führung und Management“.
Unsere Schule bildet Lehrkräfte in allen Phasen der Lehrkräftebildung aus. Eignungs- und Orientierungspraktikanten erhalten erste Einblicke in das Berufsfeld, Schulpraktikanten sammeln erste praktische Erfahrungen, während Praxissemesterstudierende im Rahmen eines Mentorenmodells gezielt begleitet werden. Das Referendariat stellt den letzten Schritt der Ausbildung dar, bei dem Lehramtsanwärterinnen und -anwärter schrittweise an eigenverantwortlichen Unterricht herangeführt werden. Alle Ausbildungsphasen bauen systematisch aufeinander auf und sind spiralcurricular angelegt, sodass eine kontinuierliche Entwicklung der professionellen Kompetenzen gewährleistet ist.
Ein besonderer Schwerpunkt unseres schulischen Ausbildungsprogramms liegt auf der Förderung der Zusammenarbeit im System Schule. Neben der Entwicklung von Fach- und Unterrichtskompetenzen lernen angehende Lehrkräfte, sich in schulische Strukturen einzufinden, Verantwortung zu übernehmen und in Teams zu arbeiten. Die enge Verzahnung zwischen Schule, Fachseminaren und Kernseminaren ermöglicht eine umfassende Begleitung und sichert eine hohe Ausbildungsqualität.
Die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Bocholt ist ausgezeichnet. Schule und Seminar stehen in engem Austausch, um eine kohärente und praxisnahe Ausbildung zu gewährleisten. In der Schule beginnen die Referendarinnen und Referendare mit Hospitationen, übernehmen dann einzelne Stundenteile, später ganze Unterrichtsstunden und schließlich komplette Unterrichtsvorhaben. Im weiteren Verlauf unterrichten sie eigenverantwortlich im vorgesehenen Rahmen. Der Einstieg ins Referendariat erfolgt mit einem vorgegebenen Stundenplan, doch zunehmend setzen die Referendarinnen und Referendare selbst Schwerpunkte in ihrer Ausbildung.
Im Praxissemester setzen wir auf ein Mentorenmodell, in dem jede Studierende und jeder Studierende für beide Fächer eine feste Betreuung erhält. Dadurch wird eine kontinuierliche Begleitung sichergestellt und eine enge Verzahnung zwischen universitärer Theorie und schulischer Praxis ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit der Universität Münster ist dabei leider weniger intensiv, als wir es uns wünschen würden, da es von Seiten der Universität wenig Kooperationsbereitschaft gibt.
Die Ausbildungsbeauftragten stehen als konstante Ansprechpartner zur Verfügung. Sie fördern die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Lehrkräften in Ausbildung, stehen im Austausch mit dem ZfsL, unterstützen in allen Ausbildungsfragen und bereiten gemeinsam den Elternsprechtag vor. Während der Zeit des selbstständigen Unterrichts werden Patenkolleginnen und Patenkollegen aus parallelen Lerngruppen zur Unterstützung eingesetzt. Auch die Schulleitung begleitet die Lehrkräfte in Ausbildung intensiv und hospitiert regelmäßig, auch im eigenverantwortlichen Unterricht. Die Schulleitung gibt regelmäßig Rückmeldungen und Hinweise zu Kompetenzerweiterungen und nimmt Einblick in die Leistungsmessung der Referendarinnen und Referendare. Besonders in der Examensvorbereitung wird gezielte Unterstützung angeboten, etwa bei der Vorbereitung des Themenbereichs „System Schule“ im Kolloquium.
Die Ausbildungskultur an unserer Schule wird stetig weiterentwickelt. Ein wesentliches Steuerungselement ist unser schulisches Begleitprogramm „Kompass“, das die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare strukturiert und kontinuierlich an neue Anforderungen anpasst. Wir verstehen Lehrkräfteausbildung als eine zentrale Aufgabe der gesamten Schule und freuen uns, junge Lehrkräfte auf ihrem Weg in den Beruf zu begleiten.
2. Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
Die kontinuierliche Fortbildung der Lehrkräfte ist ein zentraler Bestandteil der Schulentwicklung an unserer Schule.[1] Sie sichert die Qualität des Unterrichts, fördert die Weiterentwicklung professioneller Kompetenzen und stärkt die Zusammenarbeit im Kollegium.
Die Fortbildungen an unserer Schule umfassen sowohl schulinterne als auch schulexterne Maßnahmen. Einige richten sich an interessierte Kolleginnen und Kollegen, andere an feste Teams oder das gesamte Kollegium. Zentral sind dabei immer unsere aktuellen Schulentwicklungsvorhaben, die durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen begleitet und vorangetrieben werden. Neben externen Angeboten setzen wir bewusst auf interne Fortbildungen, um schulische Schwerpunkte passgenau zu bearbeiten und den kollegialen Austausch zu stärken. Dabei stehen sowohl pädagogisch-didaktische als auch fachspezifische und digitale Kompetenzen im Fokus. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf der Begleitung der Lehrkräfte mit Chancen und Herausforderungen im Bereich des Lernens und Lehrens mit digitalen Medien umzugehen. Nachdem in diesem Bereich die Fortbildungsbedarfe nur noch fokussiert für einzelne Bereiche, z. B. im Umgang mit KI, wahrgenommen werden, sind jetzt wieder Ressourcen für grundlegende pädagogische und fachliche Fortbildungsthemen frei.
Wir begrüßen die grundlegende Neuausrichtung des Fortbildungskonzepts des Landes NRW ausdrücklich. Die bisherigen Kompetenzteams konnten nicht immer den gymnasialen Fachanspruch in der gewünschten Tiefe bedienen, sodass wir gespannt darauf sind, welche konkreten Vorgaben und Strukturen die angekündigte neue Fortbildungskampagne mit sich bringen wird. Schon jetzt nehmen wir die Fachfortbildungen der Bezirksregierung Münster in der Regel als gewinnbringend wahr und nutzen diese aktiv zur Weiterqualifizierung unserer Lehrkräfte.
Innerhalb des Kollegiums fördern wir den professionellen Austausch durch kollegiale Beratung, Unterrichtshospitationen und schulübergreifende Kooperationen. Die Schulleitung unterstützt die Fortbildungsplanung aktiv, indem sie Bedarfe im Kollegium aufnimmt, passende Angebote vermittelt und Fortbildungsmaßnahmen strategisch in die Schulentwicklung einbindet. Neue Impulse aus Fortbildungen werden in Fachgruppen und Steuerungsgruppen weitergetragen, um nachhaltige Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.
Ein fester Bestandteil unserer Fortbildungskultur ist die Teilnahme an Zertifikatskursen, insbesondere in Bedarfsfächern an unserer Schule wie Praktische Philosophie, Kunst, Evangelische Religion und Informatik. Regelmäßig nehmen Lehrkräfte unserer Schule an diesen Kursen teil, um neue Qualifikationen zu erwerben und so das Fächerangebot unserer Schule zu erweitern. Darüber hinaus sind zwei unserer Lehrkräfte selbst als Zertifikatskursleitungen tätig und geben ihr fachliches und methodisch-didaktisches Wissen in Informatik und Physik an andere Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen an unserer Schule weiter.
Unser Fortbildungskonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen des Lehrberufs gerecht zu werden. Wir verstehen Fortbildung nicht als Einzelmaßnahme, sondern als fortlaufenden Prozess, der zur Qualitätssicherung unserer schulischen Arbeit beiträgt.
3. Weiterqualifizierung Schulleitung
Die kontinuierliche Weiterqualifizierung von Schulleiterin und stellvertretendem Schulleiter trägt zu einer professionellen Schulführung bei, unterstützt die gezielte Weiterentwicklung der Schule und hilft, aktuelle bildungspolitische und schulorganisatorische Herausforderungen zu bewältigen. Fortbildungen in den Bereichen Führung und Management sowie Organisation werden regelmäßig besucht, um neue Impulse für die Schulentwicklung zu erhalten, bewährte Prozesse zu optimieren und innovative Ansätze in den schulischen Alltag zu integrieren.
Die Schulleiterin nimmt daher jährlich am Deutschen Schulleitungskongress teil, um sich mit aktuellen schulischen und bildungspolitischen Themen auseinanderzusetzen, Impulse für die eigene Schule mitzunehmen und sich mit Schulleitungen aus ganz Deutschland zu vernetzen. Zusätzlich besucht sie die Schulleitungstagungen der MINT-EC-Schulen, um sich gezielt mit innovativen Ansätzen im Bereich der MINT-Förderung auseinanderzusetzen und die Weiterentwicklung des MINT-Profils der Schule voranzutreiben.
Nach der Übernahme des großen Systems Gymnasium Remigianum hat die Schulleiterin ein Schulleitungscoaching über QUA-LiS NRW absolviert. Diese Maßnahme war besonders wertvoll, um sich in die neue Rolle als Leitung einer komplexen Schule einzuarbeiten, Strukturen zu reflektieren und gezielte Führungskompetenzen weiterzuentwickeln.
Ein besonders wichtiges Element der Weiterqualifizierung ist für die Schulleiterin die kollegiale Fallberatung für Schulleitungen, die durch die Regionalen Schulberatungen (RSB) im Kreis Borken durchgeführt wird. Hier besteht die Möglichkeit, konkrete Führungs- und Managementsituationen mit anderen Schulleitungen zu besprechen, voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungen für schulische Herausforderungen zu entwickeln. Die regelmäßige Teilnahme an diesem Format trägt zur professionellen Reflexion und Weiterentwicklung bei.
Auch der stellvertretende Schulleiter nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil, insbesondere zu schulorganisatorischen und administrativen Prozessen. Ein Schwerpunkt liegt auf der intensiveren Nutzung und Optimierung des Programms UNTIS, um die Stunden- und Vertretungsplanung effizienter zu gestalten. Die Einführung des Systems SchiLd 3 bringt erhebliche Veränderungen in der Verwaltung mit sich, weshalb eine umfassende Einarbeitung notwendig sein wird. Auch die bevorstehende digitale Anmeldung neuer Schülerinnen und Schüler über das Programm Schulbewerbung wird neue Anforderungen mit sich bringen, auf die sich der stellvertretende Schulleiter frühzeitig vorbereitet.
4. Umgang mit beruflichen Anforderungen.
Die Anforderungen an Lehrkräfte sind vielfältig und entwickeln sich stetig weiter. Neben der Gestaltung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts umfasst die berufliche Tätigkeit auch pädagogische, organisatorische und administrative Aufgaben.
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schulleitung und Lehrerrat wollen wir immer mehr eine Schulkultur schaffen, die sowohl professionelle Anforderungen als auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Unser Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, in dem sich Lehrkräfte wertgeschätzt fühlen und ihre pädagogische Arbeit erfolgreich umsetzen können.
Ein zentrales Gremium zur Wahrung und Vertretung der Interessen des Kollegiums ist der Lehrerrat. Er fungiert als Ansprechpartner für die Lehrkräfte, vermittelt in Konfliktsituationen und unterstützt bei Fragen zur Arbeitsbelastung, schulischen Abläufen und dienstlichen Angelegenheiten. Der Lehrerrat trägt dazu bei, dass Anliegen der Lehrkräfte konstruktiv bearbeitet werden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und individuellen Ressourcen erhalten bleibt.
Neben der individuellen Unterstützung durch den Lehrerrat fördern wir eine kollaborative und transparente Schulkultur. Kollegiale Beratung, Teamarbeit und der regelmäßige Austausch in Fachkonferenzen sowie Arbeitsgruppen helfen dabei, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und innovative Lösungen zu entwickeln. Fortbildungsangebote, sowohl intern als auch extern, ermöglichen es den Lehrkräften, sich gezielt weiterzuentwickeln und neue pädagogische sowie didaktische Ansätze in ihren Unterricht zu integrieren.
Die Schulleitung nimmt die beruflichen Anforderungen der Lehrkräfte ernst und setzt sich aktiv für eine gute Arbeitsorganisation sowie eine faire Verteilung von Aufgaben ein. Dies schließt auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zur Unterstützung in herausfordernden Situationen ein. Wir legen Wert darauf, dass unsere Lehrkräfte nicht nur leistungsfähig, sondern auch möglichst zufrieden ihre Aufgaben wahrnehmen können.
5. Onboarding- und Offboarding
Der Einstieg und Ausstieg von Lehrkräften sind prägende Momente im Berufsleben und für das gesamte Kollegium von Bedeutung. Ein gut strukturiertes Onboarding erleichtert neuen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg in die schulischen Abläufe, während ein wertschätzendes Offboarding den Übergang in eine neue berufliche oder private Phase unterstützt. Beide Prozesse sind fest in unserer Schulkultur verankert und orientieren sich am Referenzrahmen Schulqualität NRW, insbesondere in den Bereichen „Schulkultur“ und „Führung und Management“ sowie „Professionalisierung“.
Ein gelungenes Onboarding ist essenziell, um neue Lehrkräfte schnell in die schulischen Strukturen zu integrieren und ihnen einen sicheren Rahmen für ihre Arbeit zu bieten. Unser Konzept umfasst drei zentrale Bereiche:
- Technisches Onboarding: Alle neuen Lehrkräfte erhalten eine Einführung in die digitalen Systeme der Schule, darunter Zugänge zu schulischen Plattformen wie Logineo, Elternnachricht, digitale Klassenbücher sowie die Nutzung schulinterner Software. Auch der Umgang mit UNTIS für die Vertretungsplanung gehört zu diesem Bereich.
- Pädagogisch-didaktisches Onboarding: Neue Kolleginnen und Kollegen werden mit schulischen Konzepten vertraut gemacht, z. B. der Arbeit mit Kompetenzrastern, dem parallelen Arbeiten in den Stufen oder fachspezifischen Unterrichtsprinzipien.
- Persönliches Onboarding: Neben der fachlichen und technischen Einführung ist uns die persönliche Integration ins Kollegium besonders wichtig. Dazu gehört die Hilfe bei der Platzfindung im Lehrerzimmer, Informationen über ungeschriebene Regeln des Miteinanders (z. B. Duzen und Siezen) und Hinweise zu schulischen Traditionen.
Ein zentrales Element unseres Onboarding-Prozesses ist das REMI-Lexikon – ein digitales ABECEDARIUM, das alle wichtigen Informationen hinsichtlich besonderer Räume, Kaffee- und Pausenregelungen bis hin zur Organisation des Vertretungsunterrichts enthält. Das Besondere daran: Das Remi-Lexikon wird jedes Jahr von den neuen Kolleginnen und Kollegen überarbeitet, die im Laufe des Schuljahres zur Schule gekommen sind. So bleibt es aktuell, praxisnah und bedarfsorientiert. Es ist darüber hinaus auch das geschätzte systemische Gedächtnis des Kollegiums.
Ebenso wichtig wie ein gelungener Einstieg ist ein wertschätzendes Offboarding. Kolleginnen und Kollegen, die die Schule verlassen, sollen sich gut verabschieden können. Dies geschieht bei kurzzeitiger Tätigkeit im Rahmen einer Pause im Lehrerzimmer oder bei Eintritt in den Ruhestand in einer offiziellen Verabschiedungsfeier in der Aula unserer Schule. Zudem sorgen wir für einen strukturierten Übergang wichtiger Aufgaben und ermöglichen eine geregelte Weitergabe von Materialien und Verantwortlichkeiten, sodass Kontinuität in der schulischen Arbeit gewährleistet bleibt.
6. Teamorientierung und kollegiale Fallberatung
An unserer Schule verstehen wir Teamarbeit als zentrale Säule unserer pädagogischen Arbeit, insbesondere im Kollegium. Unsere Lehrkräfte arbeiten in Jahrgangs-, Fach- und Projektteams eng zusammen, um den Unterricht kontinuierlich weiterzuentwickeln und bestmögliche Lernbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
Ein zentraler Bestandteil unserer kooperativen Schulkultur ist die kollegiale Hospitation. Sie ermöglicht es Lehrkräften, Einblicke in die Unterrichtsgestaltung ihrer Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, voneinander zu lernen und die eigene Unterrichtsqualität kontinuierlich weiterzuentwickeln. In jedem Schuljahr findet mindestens eine Hospitationsphase statt, an der alle interessierten Lehrkräfte teilnehmen können. Diese gegenseitigen Unterrichtsbesuche erfolgen sowohl innerhalb eines Fachbereichs als auch fachübergreifend.
Die Hospitationen verfolgen dabei mehrere zentrale Ziele: Zum einen soll die Unterrichtsqualität durch die Nutzung der kollegiumsinternen Ressourcen verbessert werden, zum anderen steht die Förderung von Teamarbeit und professionellem Austausch im Fokus. Gleichzeitig bieten die gegenseitigen Besuche die Möglichkeit, individuelle Fähigkeiten durch die Expertise der Kolleginnen und Kollegen zu stärken und durch wertschätzendes Feedback weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird durch die regelmäßige Hospitation eine positive Feedbackkultur eingeübt, die nicht nur das Kollegium stärkt, sondern auch nach außen wirkt. Schülerinnen, Schüler und Eltern erleben, dass Lehrkräfte als Team zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, was zu einem positiven Schulklima beiträgt.
In den kommenden Jahren soll der Nutzen der kollegialen Hospitation noch stärker kommuniziert werden, um die Beteiligung auf dem aktuellen Niveau zu halten und idealerweise zu steigern. Um dies zu erreichen, werden die Hospitationsphasen transparenter gestaltet und beispielsweise als fester Tagesordnungspunkt in Fachschaftskonferenzen verankert. Zudem sollen gezielte Maßnahmen zur Akquise ergriffen werden, um noch mehr Lehrkräfte zur Teilnahme zu motivieren, etwa durch das Teilen positiver Erfahrungen und Praxisbeispiele. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt ist die Einführung themengebundener Hospitationen, die sich an aktuellen schulischen Entwicklungen orientieren – beispielsweise wie im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unterricht.
Die Evaluation dieser Maßnahmen erfolgt durch regelmäßige Rückmeldungen der teilnehmenden Lehrkräfte, um die Wirksamkeit der Hospitationsphasen zu bewerten und weiterzuentwickeln.
7. Gleichstellung
Unsere Schule engagiert sich aktiv für die Gleichstellung aller Beschäftigten und fördert die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Dabei orientieren wir uns am Referenzrahmen Schulqualität NRW, insbesondere an den Bereichen „Schulkultur“ und „Personalentwicklung“, um eine faire und diskriminierungsfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen übernimmt Aufgaben wie die Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die Beratung bei Entlassungen auf eigenen Antrag, Fragen zur Dienstbefreiung (z. B. zum Stillen) und die Mitwirkung an Personalauswahlverfahren. Zudem sensibilisiert sie das Kollegium für die Inhalte des Gleichstellungsplans im Bereich der Bezirksregierung Münster und bildet sich regelmäßig fort. Ein zentrales Anliegen ist zudem die kontinuierliche Evaluation und Fortschreibung des Teilzeitkonzepts[2], um sicherzustellen, dass individuelle Arbeitszeitmodelle den Bedürfnissen der Lehrkräfte gerecht werden.
Aktuell liegt der Fokus auf der Konsolidierung der bestehenden Maßnahmen. Unser Ziel ist es, die Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehören die regelmäßige Überprüfung der Umsetzung rechtlicher Vorgaben an unserer Schule, gegebenenfalls die Einberufung einer Frauenversammlung sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Bezirksregierung Münster.
Zur Evaluierung der Maßnahmen wird die Zufriedenheit des Kollegiums regelmäßig erfasst und analysiert. Die Rückmeldungen fließen in die Fortschreibung unseres Teilzeit- und Gleichstellungskonzepts ein, um eine transparente und gerechte Personalentwicklung zu gewährleisten.
8. Teilhabe von Lehrkräften mit Schwerbehinderung
Unsere Schule setzt sich aktiv für die Chancengleichheit und die umfassende Teilhabe schwerbehinderter Lehrkräfte ein. Dabei orientieren wir uns am Referenzrahmen Schulqualität NRW, insbesondere an den Bereichen „Schulkultur“, „Personalentwicklung“ und „Führung und Management“. Unser Ziel ist es, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das allen Lehrkräften ermöglicht, ihre beruflichen Aufgaben unter fairen und gleichberechtigten Bedingungen auszuüben.
Um schwerbehinderten Lehrkräften eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, berücksichtigen wir individuelle Bedarfe bei der Unterrichtsverteilung und den Arbeitsbedingungen. Die Schwerbehindertenvertretung bei der Bezirksregierung Münster wird bei Beratungsbedarf von Schulleitung und betroffenen Kolleginnen und Kollegen kontaktiert. Auf Wunsch werden jährliche Teilhabegespräche vereinbart. Individuelle kleinere Anliegen werden direkt im Dialog erledigt.
[1] Siehe gesondertes Konzept FORTBILDUNG
[2] Siehe gesondertes Konzept TEILZEIT
V. Schulleitung als Führung und Management
1. Führung
Führung am Gymnasium Remigianum basiert auf Vertrauen, Transparenz und Partizipation. Die Schulleitung versteht sich als Impulsgeberin für Schulentwicklungsprozesse, Moderatorin von Veränderungsprozessen und Ansprechpartnerin für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft.
Wir setzen auf verteilte Führung, indem Verantwortung und Entscheidungsprozesse auf verschiedene Schulentwicklungsgruppen, Fachkonferenzen und Steuerungsgruppen verteilt sind. So ermöglichen wir es Lehrkräften, ihre Expertise aktiv in die Gestaltung der Schule einzubringen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern werden ebenfalls durch etablierte Beteiligungsformate in Entscheidungsprozesse einbezogen.
Ein wesentliches Führungsinstrument ist die Steuergruppe Globale Schulentwicklung, in der Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitung, des Kollegiums, der Schülerschaft und der Eltern gemeinsam an der strategischen Weiterentwicklung der Schule arbeiten. Diese Gruppe stellt sicher, dass alle wichtigen Themen kontinuierlich bearbeitet und Schulentwicklungsmaßnahmen gezielt gesteuert werden.
2. Organisation und Steuerung
Um die Steuerung der vielfältigen schulischen Prozesse effizient zu gestalten, haben wir eine klare Organisationsstruktur etabliert. Die Schulleitung besteht aus der Schulleiterin, dem stellvertretenden Schulleiter sowie mehreren ernannten Koordinatorinnen und Koordinatoren, die für verschiedene Schulbereiche verantwortlich sind. Diese sind im Geschäftsverteilungsplan, der auf der Homepage in aktueller Fassung zur Verfügung steht, abgebildet.
Die regelmäßige Schulleitungssitzung gewährleistet den kontinuierlichen Austausch über zentrale Themen der Schulorganisation. Die Ergebnisse dieser Sitzungen werden gezielt an die relevanten Gremien weitergegeben, um eine transparente Kommunikation sicherzustellen.
Ein weiteres wichtiges Element unserer Schulorganisation ist das digitale Informations- und Kommunikationssystem. Wichtige Mitteilungen, Protokolle und Planungen werden über die Plattform Logineo NRW und das interne digitale Klassenbuch gesteuert, sodass alle Beteiligten stets gut informiert sind. Der digitale Schulkalender wird tagesaktuell geführt, so dass alle Beteiligten stets informiert sind.
3. Ressourcenplanung
Eine vorausschauende und strategische Ressourcenplanung ist essenziell für eine gut funktionierende Schule. Am Gymnasium Remigianum verfolgen wir den Grundsatz, dass personelle, räumliche und finanzielle Ressourcen effizient und bedarfsgerecht eingesetzt werden, um bestmögliche Bedingungen für Unterricht und Schulentwicklung zu schaffen.
Personaleinsatz:
Die Unterrichtsverteilung erfolgt auf Grundlage der individuellen Fächerkombinationen und unter Berücksichtigung persönlicher Belange, soweit es schulorganisatorisch möglich ist. Durch klare Vertretungskonzepte wird eine verlässliche Unterrichtsversorgung gewährleistet, sodass Unterrichtsausfälle minimiert werden. Die gezielte Förderung von Teamstrukturen (z. B. Klassenleitungsteams, Fachschaftskoordination) entlastet die Lehrkräfte und stärkt die Zusammenarbeit.
Sach- und Raumressourcen:
Der Schulträger sorgt für eine moderne Ausstattung der Unterrichtsräume mit interaktiven Smartboards, Dokumentenkameras und digitalen Lehrbüchern.
Die digitale Infrastruktur wird kontinuierlich ausgebaut, um eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen. Die Raumplanung erfolgt datenbasiert und bedarfsgerecht, um den gestiegenen Schülerzahlen und den Anforderungen des offenen Ganztags gerecht zu werden.
4. Personaleinsatz und -entwicklung
Die kontinuierliche Fortbildung und Qualifizierung unserer Lehrkräfte ist ein zentraler Bestandteil unseres Führungskonzepts. Die Schulleitung fördert die individuelle und kollektive Weiterentwicklung des Kollegiums, um die Unterrichtsqualität und Innovationskraft der Schule langfristig zu sichern.
Maßnahmen der Personalentwicklung:
- Regelmäßige interne und externe Fortbildungsangebote zu fachspezifischen, pädagogischen und digitalen Themen.
- Mentoring-Programme für neue Lehrkräfte sowie eine strukturierte Einarbeitung durch das Onboarding-Konzept „REMI-Lexikon“.
- Förderung der kollegialen Hospitation und Beratung, um voneinander zu lernen und eine offene Feedbackkultur zu etablieren.
- Möglichkeit zur Übernahme zusätzlicher Verantwortung (z. B. Steuergruppenarbeit, Arbeitsgruppenleitung), um Führungs- und Managementkompetenzen zu entwickeln.
5. Strategien der Qualitätsentwicklung
Eine nachhaltige Schulentwicklung kann nur auf Basis verlässlicher Daten und regelmäßiger Evaluation erfolgen. Deshalb setzen wir auf ein strukturiertes Qualitätsmanagement, das alle wesentlichen schulischen Prozesse kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt. [1].
6. Auswahl Schulentwicklungsprozesse seit 2022
Folgende Schulentwicklungsprozesse sind in den letzten Jahren vollständig umgesetzt worden und werden je nach Charakter entweder bedarfs- bzw. anlassbezogen oder regelmäßig evaluiert:
- Zertifizierung zur Europaschule in NRW
- Fortschreibung MINT-EC (Magische Forschernacht für Grundschüler, Neuauflage der Mint-Gala am Ende des Schuljahres, Ausbau Exzellenz-Förderung)
- Zertifizierung zur Digitalen Schule
- Wiederaufnahme der Schulprogrammarbeit (unter Beachtung der Zielvereinbarungen)
- Prozess der Digitalisierung
- KI-Strategie, hier auch Referenzschule in einem neuen Netzwerk Zukunftsschulen NRW
- umfängliche Nutzung von Logineo NRW und LMS als Leit-Tool
- Qualitätssteigerung der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Homepage, Presse, Social Media
- Weiterentwicklung Fahrtenkonzept
- Konzept Unterrichtsentwicklung digital
- Konzept zum Umgang mit privaten digitalen Endgeräten
- Systematisierung Bildung für nachhaltige Entwicklung RemiEARTH
- Ausbau Schulkultur: „Rem(m)i-Demmi-Tag“ als Schulkulturtag im März
- Stärkung des Beratungsteams, Zusammenarbeit mit der RSB, Kinderschutzkonzept
- Qualitätssteigerung in der Erst- und Anschlussförderung
- Aktiver Umgang mit diskriminierendem Verhalten
- Förderung der Demokratiebildung (Frau Ministerin D. Feller ist bereits auf das Gymnasium Remigianum aufmerksam geworden >Schulbesuch am Tag des Grundgesetzes am 23.05.2025)
- Fortschreibung KAoA (Terminierung Standardelemente, Ausweitung der Angebote)
- Qualitätssteigerung der Fachkonferenzarbeit
- Neuausrichtung des offenen Ganztags
- Fachübergreifende Arbeit am neuen Konzept „RemiLIESTLAUT!“ (begonnen)
- Verbesserung der Qualität des Vertretungsunterrichts
- Kommunikationskonzept
- Schulordnung
- Teilzeitkonzept
- Konzept Medienscouts
- Konzept LRS
- Ausbau der Prävention (Straßenverkehr, Alkohol, Cannabis)
- Ausbau Sportbereich (Stadtradeln, Citylauf, Jugend trainiert für Olympia, Sportabzeichen)
- Neuauflage Geschäftsverteilungsplan
- Digitaler Schulkalender
- Einführung eines digitalen Klassenbuchs
- Digitale Terminierung von Klassenarbeiten
- Nutzung einer digitalen Form der Heftführung (GoodNotes) für alle
- Ausweitung der Nutzung von Untis (Wertrechnung, Blockungen)
- Einführung von Elternnachricht
- Systematisierung der Beurlaubung von SuS´
- Ausstattung: Anpassung der Bedarfe (z. B. im Übergangsmanagement)
7. Geplante Schulentwicklungsprozesse ab Schuljahr 2025-2026
- Implementation von Schulsozialarbeit (Stellenzuweisung in Aussicht)
- Stärkung der Lehrergesundheit: Ressourcennutzung und Resilienz Stärkung
- Fachübergreifende Arbeit Konzept „REMI liest laut!“ (begonnen)
- Ausbau der datenbasierten Schulentwicklung (z. B. Systematisierung Evaluationsprozesse)
- Überprüfung des Umgangs mit dem Sozialcurriculum
- Übergangsmanagement (Antrag an die Schulentwicklungskonferenz im MSB geplant)
- Schulhofgestaltung (Bewegung, Schatten, Nachhaltigkeit) à Zuständigkeitsgrenzen
- Vorbereitung Implementation neue APO-GOSt, insbesondere im Bereich der Projektkurse
- Raumkonzept neue Dépendance (nötig wegen höherer Schülerzahlen)
- Evaluation flächendeckender iPad-Einsatz (Schuljahr 2027-2028)
- …
Indikatoren und Erfüllungsgrade zur Überprüfung aktueller Schulentwicklungsprozesse:
- Implementation von Schulsozialarbeit
Indikatoren:
- Stellenbesetzung erfolgt
- Präsenz und Sprechzeiten der Schulsozialarbeit veröffentlicht
- Anzahl und Art der durchgeführten Maßnahmen (Beratungsgespräche, Präventionsprojekte)
- Rückmeldungen von Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern (z. B. durch Befragungen)
- Erfüllungsgrad: Konzept in Entwicklung
- Stärkung der Lehrergesundheit: Ressourcennutzung und Resilienzstärkung
Indikatoren:
- Anzahl der angebotenen Fortbildungen und Workshops zur Resilienzförderung
- Teilnahmequote an Gesundheitsförderungsmaßnahmen
- Zufriedenheit der Lehrkräfte (z. B. durch Befragungen)
- Reduzierung von Fehlzeiten durch Krankheit
- Erfüllungsgrad: Erste Maßnahmen umgesetzt
- Fachübergreifende Arbeit: Konzept „REMI liest laut!“
Indikatoren:
- Anzahl der beteiligten Fachschaften und Lehrkräfte
- Integration des Konzepts in den Fachunterricht
- Schülerbeteiligung (z. B. Anzahl der gelesenen Bücher, Lesewettbewerbe)
- Evaluationsrückmeldungen der Lehrkräfte und Schüler:innen
- Erfüllungsgrad: Pilotphase
- Ausbau der datenbasierten Schulentwicklung
Indikatoren:
- Einführung einheitlicher Evaluationsinstrumente
- Regelmäßige Datenerhebung zu Unterrichtsqualität und Schulentwicklung
- Nutzung der Daten zur gezielten Schulentwicklungssteuerung
- Reflexion und Anpassung der Maßnahmen basierend auf den Daten
- Erfüllungsgrad: Erste Ansätze erarbeitet / Evaluationsprozesse systematisiert
- Überprüfung des Umgangs mit dem Sozialcurriculum
Indikatoren:
- Aktualisierung und Anpassung des Sozialcurriculums
- Integration in Fachunterricht und Projektarbeit
- Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler:innen mit den Inhalten
- Langfristige Wirksamkeit (z. B. anhand von Verhaltensanalysen)
- Erfüllungsgrad: Konzeptüberprüfung gestartet
- Übergangsmanagement
Indikatoren:
- Genehmigung des Antrags durch die Schulentwicklungskonferenz
- Entwicklung und Umsetzung eines Übergangskonzepts
- Anzahl und Art der unterstützenden Maßnahmen für Schüler:innen
- Evaluation der Wirksamkeit durch Schüler:innen- und Elternfeedback
- Erfüllungsgrad: Konzeptentwicklung begonnen
- Schulhofgestaltung (Bewegung, Schatten, Nachhaltigkeit)
Indikatoren:
- Klärung der Zuständigkeiten und Finanzierung
- Umsetzung erster baulicher Maßnahmen
- Nutzung und Akzeptanz der neuen Schulhofgestaltung durch Schüler:innen
- Erfüllungsgrad: Gespräche mit Schulträger aufgenommen
- Vorbereitung der Implementation der neuen APO-GOSt (Projektkurse etc.)
Indikatoren:
- Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte durchgeführt
- Anpassung der schulinternen Curricula
- Pilotierung erster Projektkurse
- Evaluation der Neuerungen durch Lehrkräfte und Schüler:innen
- Erfüllungsgrad: Informationsphase gestartet
- Raumkonzept für die neue Dépendance
Indikatoren:
- Raumbedarfsermittlung abgeschlossen
- Bau- oder Umbaumaßnahmen gestartet
- Nutzung der neuen Räume erfolgt
- Erfüllungsgrad: Bedarfsermittlung abgeschlossen / Konzeptentwicklung gestartet
- Evaluation des flächendeckenden iPad-Einsatzes (Schuljahr 2027-2028)
Indikatoren:
- Entwicklung eines Evaluationskonzepts
- Durchführung der ersten Evaluationen (Schülerinnen und Schüler , Lehrkräfte, Eltern)
- Identifikation von Optimierungsbedarf
- Anpassungen basierend auf den Ergebnissen
- Erfüllungsgrad: Planung der Evaluation
Diese Indikatoren und Erfüllungsgrade helfen dabei, den Fortschritt der Schulentwicklungsprozesse systematisch zu überprüfen und gezielt nachzusteuern. Sie bieten Transparenz für alle Beteiligten und unterstützen eine nachhaltige Qualitätsentwicklung.
[1] Siehe dazu ausführlich das Konzept EVALUATION im Anhang und weiter oben den Punkt Evaluation und Weiterentwicklung des Schulprogramms.
